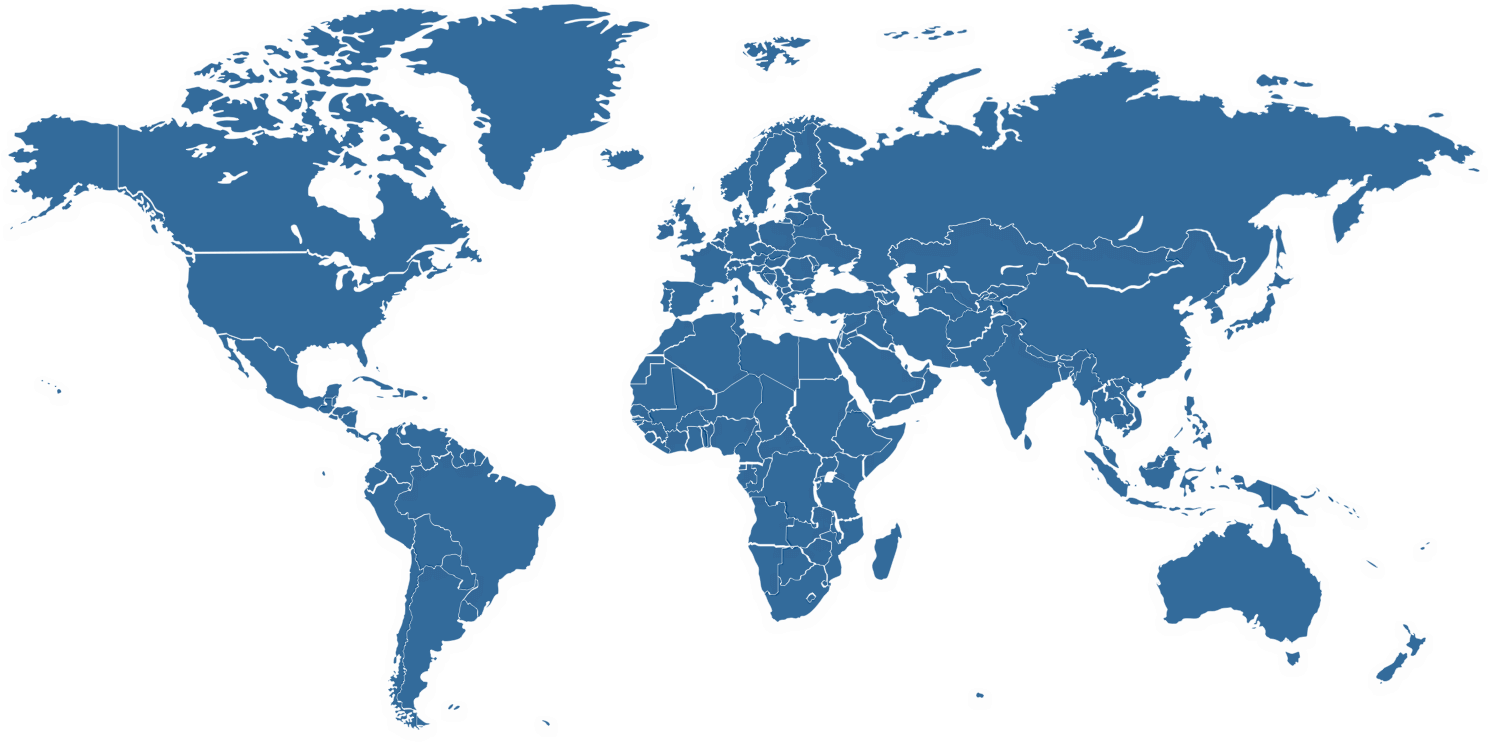Albert Ramdin,1958 in Suriname geboren, studierte Sozialgeografie in Amsterdam und begann seine diplomatische Karriere 1997, als er Suriname bei der OAS als Ständiger Vertreter repräsentierte. Von 2005 bis 2015 war er bereits stellvertretender Generalsekretär der OAS. Nach seiner Rückkehr nach Suriname im Jahr 2015 arbeitete er für ein US-amerikanisches Bergbauunternehmen. Seit 2020 war er Außenminister von Suriname und engagiert sich aktiv in regionalen Organisationen wie der Karibischen Gemeinschaft (CARICOM) und der Vereinigung der Karibischen Staaten (ACS). Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Organisation gilt Ramdin als Kenner der OAS.
Die Wahl des Generalsekretärs der OAS erfolgt durch die Generalversammlung der Organisation, die derzeit aus Vertretern aller 33 Mitgliedstaaten besteht. Jedes der Vollmitglieder hat eine Stimme. Für die Wahl ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre, eine einmalige Wiederwahl ist möglich. Im Vorfeld der Wahl 2025 zog der paraguayische Außenminister Rubén Ramírez Lezcano seine Kandidatur zurück, nachdem mehrere Staaten, darunter Brasilien, Chile, Kolumbien, Uruguay und Bolivien, ihre Unterstützung für Ramdin erklärt hatten. Ramírez Lezcanos Entscheidung wurde durch den brasilianischen Präsidenten Lula da Silva maßgeblich beeinflusst, denn während Ramdin nicht nur als Kandidat der Karibischen Gemeinschaft (CARICOM), sondern auch Brasiliens und seiner Verbündeten galt, wusste Ramírez Lezcano die USA hinter sich. Die Entscheidung einiger südamerikanischer Länder, Ramdin statt Lezcano zu unterstützen, kann als Reaktion auf die aktuelle Politik der USA in der Region interpretiert werden. Insbesondere die aggressive Haltung der USA in der Zoll- und Migrationspolitik unter der Trump-Administration gegenüber einer Reihe lateinamerikanischer Staaten führte dazu, dass einige Länder einen Kandidaten bevorzugten, der als Gegengewicht zu den USA fungieren könnte.
Politische Polarisierung in der OAS
Die OAS ist ein Forum für die Zusammenarbeit zwischen den Staaten Nord- und Lateinamerikas und der Karibik und ist alles andere als frei von politischen Spannungen. Differenzen zwischen linken und marktwirtschaftlich-orientierten Regierungen führen immer wieder zu verbalen Auseinandersetzungen. Die sogenannte linke „Rosa Galaxie“ bezeichnet eine Gruppe von Staaten von sozialdemokratischen Regierungen bis sozialistisch-autoritären Regimen, die häufig gemeinsame Positionen vertreten oder zumindest kaum gegenseitige Kritik üben. Zu den gemäßigt linken Regierungen zählen derzeit Brasilien, Chile, Mexiko (mit radikalisierender Tendenz) und Uruguay. Eine schärfere linke Rhetorik findet man in Bolivien und Kolumbien vor. Den linksextremen Rand bilden die Diktaturen Venezuela, Kuba und Nicaragua, wobei letzteres Land seit November 2023 kein Mitglied der OAS mehr ist. Mit Ausnahme von Präsident Boric in Chile gehen die genannten Staaten der Rosa Galaxie verhältnismäßig zurückhaltend mit Problemfällen in autoritären Regimen um, selbst wenn grundlegende Menschenrechte missachtet werden oder es sich gar um Fälle von Staatsterrorismus handelt.
Dem linken Lager stehen für gewöhnlich die USA gegenüber, gefolgt von Kanada und einer Reihe von Staaten, deren Regierungen überwiegend marktliberale Politikansätze verfolgen wie auch eine strikte Einhaltung der Menschenrechte einfordern.
In der jüngsten Vergangenheit veranschaulichten sich die ideologischen Grabenkämpfe, die die OAS dominierten, im Umgang mit der Diktatur in Caracas. Die Frage, wie mit Venezuela umzugehen sei, zeigte immer wieder die ideologische Dichotomie innerhalb der OAS deutlich auf. Jegliche Vermittlungsversuche Almagros scheiterten an der aggressiven Strategie des Machterhalts von Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro. In der Folge wurde Almagro oftmals Opfer von Verbalattacken und Hasstiraden der Linksdiktaturen. Über zehn Jahre gelang es ihm kaum, Menschenrechtsvergehen von Linksdiktaturen im Rahmen von OAS-Resolutionen anzuprangern, da die Mehrheit des linken Lagers diese verwässerten, relativierten oder schlichtweg nicht mittrugen. Nicht selten musste sich Almagro – selbst Sozialdemokrat – des unzutreffenden Vorwurfs erwehren, eine Marionette Washingtons zu seinen, sodass Konsens in kritischen Fragen nur selten möglich war.
Ramdin hat im Vorfeld seiner Wahl angekündigt, den Dialog mit Venezuela erneut suchen zu wollen, um regionale Herausforderungen wie Migration, Organisierte Kriminalität und den Klimawandel gemeinsam anzugehen. Kritiker werfen ihm jedoch vor, dass ein solcher Dialog die Diktatur von Maduro und das gefälschte Wahlergebnis von 2024 legitimieren könnte. Venezuela könnte sich weiter ermuntert fühlen, demokratisch gewählte Regierungen in der Region zu destabilisieren, wie es zuletzt bei der Wahleinmischung zugunsten der linken Präsidentschaftskandidatin Luisa González in Ecuador der Fall war.
Dass es um den Erfolg eines Dialogversuches mit Caracas schlecht bestellt ist, zeigte das jüngste Ereignis, bei dem fünf Oppositionelle durch eine geheimdienstliche Operation der Vereinigten Staaten aus der leerstehenden argentinischen Botschaft in Caracas befreit wurden, die von venezolanischen Sicherheitskräften bewacht und abgeriegelt wurde. Die Aktion erfolgte, nachdem jegliche Aufrufe und Vermittlungsversuche 14 Monate lang scheiterten. Vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse dürften in der Causa Venezuela weitere diplomatischen Versuche der Entspannung im Rahmen der OAS aussichtslos sein. Die Polarisierung der OAS wird weiterhin Bestand haben, besonders in Fragen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
Die Rolle der USA und die finanziellen Herausforderungen der OAS
Die USA tragen etwa 50 bis 60 Prozent des Gesamtbudgets und spielen traditionell eine dominante Rolle in der OAS gespielt. Es wird spekuliert, dass die USA unter der Regierung Trump ihre finanziellen Beiträge zur OAS aussetzen oder reduzieren könnten. Ein solcher Schritt würde die finanzielle Stabilität der Organisation erheblich beeinträchtigen und könnte zu einem Teilrückzug der USA aus der OAS führen. Eine gänzliche Einstellung der Zahlung scheint hingegen unwahrscheinlich zu sein. Laut einer Mitarbeiterin der Organisation wird erwartet, dass es sich bei den möglichen finanziellen Reduzierungen oder Aussetzungen um ein vorübergehendes Druckmittel handelt, um eine Verschlankung der OAS zu erreichen.
Doch nicht nur die Zahlungsmoral der USA ist gering. Etwa 40 Prozent der Mitgliedstaaten sind mit ihren Beiträgen im Rückstand. Diese Zahlungsrückstände erschweren die Durchführung von Projekten und beeinträchtigen die Effektivität der Organisation. Die finanzielle Schieflage wird vermutlich zu Kürzungen in der Projektarbeit führen, maßgeblich bei der Demokratieförderung und Menschenrechtsarbeit sowie Entwicklungs- und Kooperationsprojekte. Ob es so weit gehen wird, dass die Fähigkeit der OAS, ihre Kernaufgaben zu erfüllen, beeinträchtigt wird, bleibt abzuwarten.
Die US-Regierung wird angesichts der transaktionalen Außenpolitik ihre finanzielle Unterstützung von der ausreichenden Berücksichtigung von US-Interessen abhängig machen. „Sie brauchen uns mehr, als dass wir sie brauchen,“ so charakterisierte Donald Trump seine harte Haltung gegenüber den lateinamerikanischen Staaten. Ramdin wird viel diplomatisches Geschick für seine neue Aufgaben benötigen, denn weder werden die USA ohne Gegenleistung zu alten Finanzierungsmodalitäten zurückkehren, noch werden die lateinamerikanischen Staaten, die sich nicht selten in multilateralen Organisationen auf Pflichtbeiträge beschränken, Finanzierungslücken schließen. Es stellt sich daher die Frage, wie viel Spielraum Ramdin überhaupt bleibt. Seine Amtszeit wird wohl eher von dem Management der finanziellen Engpässe geprägt sein.
Kanada ist mit zwölf Prozent zweitgrößter Geldgeber der OAS und spielt eine wichtige Rolle, insbesondere bei der Finanzierung von OAS-Wahlbeobachtungsmissionen. Kanadas Engagement wird als Beispiel für eine konstruktive Zusammenarbeit angesehen, die auf Prinzipien wie Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit basiert. Es bleibt zu hoffen, dass die Wahlbeobachtungen weiterhin durchgeführt werden und nicht Kürzungen bzw. Umschichtungen zum Opfer fallen werden.
Ramdin: Karibische Anliegen im Fokus
Die Karibische Gemeinschaft (CARICOM) umfasst 15 Vollmitglieder und hat in der OAS ein entsprechend hohes Stimmengewicht. Zweifelsohne stand die CARICOM auch deswegen geschlossen hinter ihrem Kandidaten, von dem man sich erhofft, er werde mehr für die Region tun können. In der Tat versprach Ramdin sich für die Staaten der Karibik einzusetzen, doch die Herausforderungen sind vielfältig:
In der Karibik leben über 44 Millionen Menschen. Die Inselstaaten könnten nicht heterogener sein. Eine jahrhundertelange Kolonialzeit, geprägt durch neun europäische Kolonialmächte und die USA, eine brutale indigene und afrikanische Sklavereigeschichte haben einen einmaligen Fußabdruck in der ethnischen, sprachlichen und kulturellen Zusammensetzung hinterlassen. In der wechselvollen Geschichte finden maßgebliche Ursachen für Unterentwicklung, aber auch Reichtum ihren Ursprung. Während der eine Inselstaat oder manches Überseeterritorium den internationalen Jetset empfängt, herrschen auf der Nachbarinsel Armut und Gewalt. Traurigstes Beispiel ist Haiti, das mit seinen über elf Millionen Einwohnern in einem schier hoffnungslosen Kampf gegen Bandenkriminalität versinkt. Auch in Kuba werden Menschen unterdrückt, wenn auch nicht von Banden, sondern vom kommunistischen Regime, das jegliche Freiheitsbestrebungen mit voller Härte ahndet. 1962 wurde Kuba aus der OAS ausgeschlossen und erhielt im Rahmen der Entspannungspolitik 2009 die Einladung zum Wiedereintritt, die bisher nicht angenommen wurde.
Eine weitere Herausforderung in der Karibik stellt die zunehmende Ausbreitung der Organisierten Kriminalität dar, da etliche Transportrouten von Kokain durch die Region führen. Vor allem Trinidad und Tobago, Jamaika und die Bahamas haben mit drogenbedingter Gewalt zu kämpfen.
Im Weiteren sind die Inseln der Karibik stark vom Klimawandel betroffen, etwa durch stärkere Dürren oder Hurrikane. Die Anpassung an den Klimawandel, wie bspw. durch einen verbesserten Küstenschutz ist kostenintensiv, aber dringend notwendig. Ein entschlossenes Vorgehen ist entscheidend, um die Widerstandsfähigkeit der Region zu erhöhen und die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu mildern.
Vor dem Hintergrund der finanziellen Nöte und ideologischen Grabenkämpfe dürfte es Ramdin schwer haben, die Karibikstaaten über das gewöhnliche Maß hinaus unterstützen zu können. Der Region wäre schon viel geholfen, wenn er auf die enormen Herausforderungen der Karibik hinweist – insbesondere die Folgen des Klimawandels – und dieser weitere internationale Aufmerksamkeit verschafft. Mit der Ausrichtung des OAS-Gipfels „Cumbre de las Américas“ im Dezember in der Dominikanischen Republik ist zumindest ein Anfang gemacht.
Kritischer Ausblick auf Ramdins Amtszeit
Albert Ramdin übernimmt die OAS in einem politisch polarisierten und finanziell angeschlagenen Umfeld. Sein Vorgänger Luis Almagro beendet seine zweite Amtszeit mit großer Ernüchterung. Weder konnte er der Organisation zu maßgeblicher Relevanz in der westlichen Hemisphäre verhelfen, noch konnte er grundsätzliche Uneinigkeiten überwinden. Ob Ramdin eine glücklichere Hand bei der Führung der OAS hat, bleibt abzuwarten. Seine Bemühungen um Dialog und Zusammenarbeit könnten auf Widerstand stoßen, insbesondere von Staaten, die autoritäre Regime unterstützen. Er muss sich auf ein diplomatisches Minenfeld begeben, um die OAS wieder auf Kurs zu bringen und die Organisation zu stärken. In Zeiten, in denen multilaterale Organisationen unter Druck stehen und multilaterale Lösungsansätze an Zustimmung verlieren zu scheinen, kann man von ihm nur ein standfestes und vermittelndes Auftreten erhoffen.