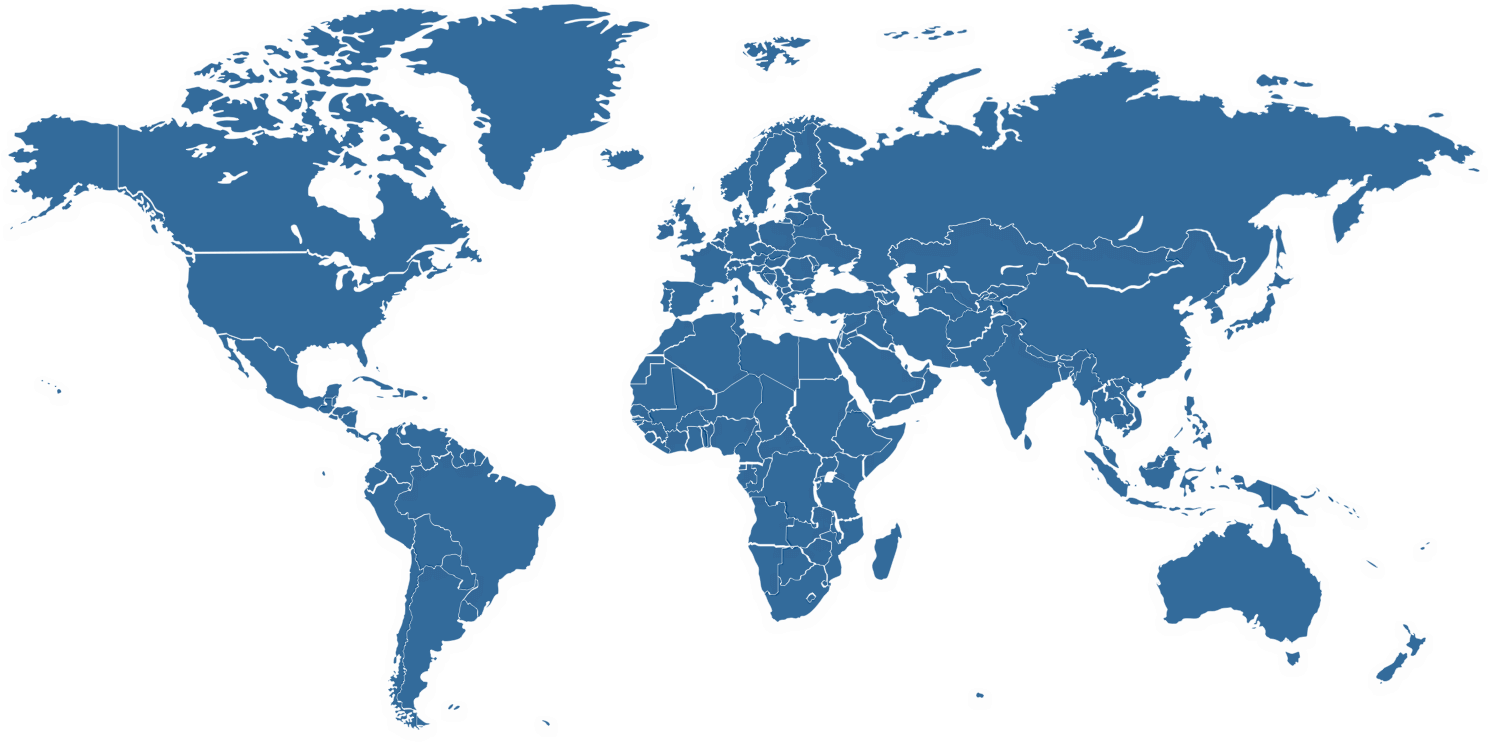Faycal ist überglücklich. Es war nur ein
Anruf, der sein ganzes Leben gerettet hat.
So jedenfalls fühlt es sich für ihn an. Vor
gut einem Monat hatte er sich bei einer in
Tunis ansässigen deutschen Firma beworben.
In den vergangenen vier Jahren, nach
seinem Diplomabschluss als Buchhalter, hat
er Hunderte von Bewerbungen geschrieben.
Auch dieses Verfahren zog sich lange hin,
mehrere Interviews, Dutzende weitere, hochqualifizierte
Kandidaten. Dann, vorgestern,
ein erneutes Interview. Gestern um 10 Uhr
klingelte schließlich das Telefon: „Sie haben
uns überzeugt, wir möchten Sie gerne einstellen.
Können Sie Montag vorbeikommen, um
die vertraglichen Dinge zu regeln?“ Beinahe
hättes es ihm die Sprache verschlagen. „Ich
werde da sein, vielen herzlichen Dank!“
Enttäuschte Erwartungen
Nicht viele junge Menschen in Nordafrika
haben in diesen Zeiten das Glück, einen solchen
Anruf zu erhalten. Dabei ist Faycals
Biografie symptomatisch und exemplarisch
zugleich für die Altersgruppe derjenigen
zwischen 17 und 24 Jahren in der Region
von Marokko bis Ägypten. Viele von ihnen
standen am Anfang mit auf der Avenue
Bourguiba und dem Tahrir Platz, riefen
nach „Freiheit“, „Würde“ und – ja, vor allem
auch – „Brot“, sprich Arbeit.
Die Jugendarbeitslosigkeit in den Ländern
Nordafrikas ist seit Jahrzehnten eine
der höchsten der Welt. Ägypten führte den
traurigen Rekord mit 49% an, gefolgt von
Tunesien mit 31%, knapp dahinter Libyen
mit 27%. Analysten wiesen bereits seit Jahren
darauf hin, dass die Gemengelage einer großen
Jugendbevölkerung zusammen mit den
von der Politik und Gesellschaft in Aussicht
gestellten Wohlstandsversprechen und einem
relativ hohen Bildungsniveau, wie es zum
Beispiel in Tunesien der Fall ist, zu erheblichen
gesellschaftlichen Konflikten führen
würden.
Dann kam die Revolution, die Erwartungen
waren hoch, naturgemäß zu hoch,
und der politische Transformationsprozess
scheint in nahezu allen Ländern derart die
Kräfte zu absorbieren, dass die ursächlichen
wirtschaftlichen und sozialen Fragen kaum
angegangen werden. Dabei war es gerade das
Potential der Jugendbevölkerung, das den
Umbrüchen diesen Mobilisierungsschub
verlieh.
Zu viele Studenten, zu wenig Handwerker
Die Arbeitsmarktsituation vieler Länder in
der Region ist weitgehend hausgemacht. Obwohl
Länder wie Ägypten, Libyen, Tunesien
und Algerien zeitweise über ein Wirtschaftswachstum
von über fünf bis sieben Prozent
verfügten, mit dem sie in der Lage gewesen
wären, entsprechende Reformen im beruflichen
wie universitären Ausbildungsbereich
zu meistern, pf legten sie lieber weiterhin
das Bild eines nahezu staatsmonopolistisch
regulierten Arbeitsmarktes: Mit dem kostenfreien
Zugang zu den Universitäten gab es in
Ägypten quasi die Aussicht auf eine staatliche
Anstellung gleich mitgeliefert. Kein Wunder,
dass eine Beschäftigung im öffentlichen
Dienst daher den meisten wie ein goldener
Handschlag vorkam, Pension inklusive, wenngleich
auf niedrigem Niveau. Der staatliche
Sektor, der bereits vor der Revolution seine
eigentlichen Absorbationskapazitäten weit
überschritten hatte, wurde weiter überdehnt.
Der Vernachlässigung des Privatsektors und
dessen mangelnder Ausdifferenzierung ist es
zudem zuzuschreiben, dass dort nicht ausreichend
Arbeitsplätze geschaffen wurden.
Die eigentliche Misere vermittelt jedoch
der Blick auf die dadurch bedingte, völlig
asymmetrische Struktur des Arbeitsmarktes,
der wie im Falle Tunesiens von einer „quantitativen
wie qualitativen Unausgeglichenheit“
geprägt ist, wie der Wirtschaftswissenschaftler
Mohammed Kriaa erklärt. Knapp 35% der
Hochschulabgänger sind derzeit arbeitslos,
wobei sich die generelle Arbeitslosenquote
bei rund 18% bewegt. Tunesien hat damit,
wie auch andere Länder der Region, ein im
Grunde selbstgeschaffenes Luxusproblem
zu lösen: Hunderttausende besuchten die
Universitäten, was zwar zu einem gewissen
gesellschaftlichen Ansehen geführt hat, jedoch
letztlich zu keiner beruflichen Perspektive.
Jamel Boumedienne vom tunesischen
Zentrum für Analyse und wirtschaftliche
Intelligenz stellt die aktuelle Situation nicht
besser dar: Mit Blick auf die vorhandenen
Bildungsmöglichkeiten entfielen immer
noch 10% auf den Bereich der beruflichen
Bildung, 90% auf den universitären Bereich.
Und dies, obwohl die Nachfrage genau umgekehrt
ist. Gut 120.000 Arbeitsplätze im
handwerklichen Bereich können derzeit in
Tunesien nicht besetzt werden, weil die Betriebe
Schwierigkeiten haben, entsprechend
qualifiziertes Personal zu finden. Schon wird
von der Anwerbung von Arbeitsmigranten
gesprochen, was nur zynisch stimmen kann.
Die regionalen Prognosen deuten zudem
keine Verbesserung der Gesamtsituation an;
nach Schätzungen der Vereinten Nationen
wird der Anteil Jugendlicher in der MENARegion,
die auf den Arbeitsmarkt drängen,
von derzeit 41 Millionen auf 47 Millionen
im Jahre 2035 steigen.
Den Druck aus dem Kessel nehmen
Zusammen mit der Privatwirtschaft haben
die Regierungen der Länder versucht, auf
diese Entwicklungen zu reagieren, jedoch
überlagern die nahezu täglichen politischen
Spannungen in Ägypten, Tunesien und Libyen
eine Konzentration auf die Bekämpfung
der Jugendarbeitslosigkeit.
Deutschland und Europa haben Ausbildungspartnerschaften
ins Leben gerufen, die zum Ziel haben, durch die weitere Professionalisierung
von Arbeitslosen den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Die Länder selbst
versuchen das Problem anzugehen, indem
sie einerseits weitere Arbeitsplätze im öffentlichen
Dienst schaffen sowie andererseits den
privatwirtschaftlichen Unternehmen durch
die Übernahme eines Teils der Gehälter
Anreize geben, mehr junge Menschen einzustellen.
Doch zahlreiche dieser Maßnahmen bleiben
an der Oberf läche, da sie nicht auf
eine grundsätzliche Umstrukturierung der
Wirtschaft abzielen, sondern versuchen,
kurzfristig die Symptome zu beheben. Auf
Dauer werden sie die Staatsbudgets, deren
Abhängigkeit von ausländischer Unterstützung
ohnehin weiter wächst, noch zusätzlich
belasten. Demgegenüber sind Maßnahmen
wie die Mikrokreditvergabe an Jungunternehmer,
die derzeit beispielsweise in Tunesien
verstärkt praktiziert wird, nachhaltiger.
Selbst wenn nur ein Teil derjenigen, die sich
anschicken, ihr Schicksal selbst in die Hand
zu nehmen, erfolgreich ist, dürfte dies wirtschaftspolitisch
sinnvoller sein, als weiterhin
auf staatliche Intervention zu hoffen.
Kosten statt Geschenke
Zugegebenermaßen ist die Politik in einem
Dilemma. Die neu gewählten Machthaber in
Ägypten, Libyen und Tunesien sowie die unter
Druck geratenen Eliten in Algier und Rabat
müssen das bewältigen, was sie als Erbe
angetreten haben beziehungsweise was über
Jahrzehnte hinweg ignoriert wurde. Dabei
wollen gerade die neuen Herrscher am Nil
wie im alten Karthago der Bevölkerung nicht
unbedingt vorübergehende Härten zumuten,
sondern würden lieber Geschenke verteilen,
gerade auch mit Blick auf Neuwahlen.
Kurzfristig mag die Gesamtzahl der aufgelegten
Programme Entspannung am Arbeitsmarkt
schaffen, mittel- bis langfristig jedoch
kommen die Länder der Region an einem
grundlegenden Umbau ihrer Wirtschaft und
des Arbeitsmarktes nicht vorbei, einschließlich
der damit vorübergehend verbundenen Transformationskosten.
Neben einer wettbewerbsfähigen
Industrie, einem flexiblen Arbeitsmarkt,
offenem Gütertransport und der Reform des
Ausbildungsbereichs zählt dazu vor allem,
die Attraktivität der Region für ausländische
Investitionen zu stärken, um Wachstum und
somit Arbeitsplätze im produktiven Bereich
zu schaffen. In einem Kontext zunehmender
politischer Spannungen wie in Ägypten und
Tunesien wird dies schwieriger, bleibt aber
eine conditio sine qua non, denn Sicherheit,
körperliche wie rechtliche, ist und bleibt eine
unverzichtbare Bedingung für Investitionen.
In der Gesellschaft angekommen
Faycal kann vorerst seinen Träumen freien
Lauf lassen. Mit der neuen Stelle verbinden
sich für ihn nicht nur Arbeit und Lohn, sondern
er kann endlich heiraten, was ohne eine
feste Stelle familiär und gesellschaftlich kaum
akzeptiert würde. Für ihn, der glaubte, bereits
resignieren zu müssen, hat sich dadurch
eine neue Chance ergeben voranzukommen
und endlich gesellschaftlich partizipieren zu
können. Es wird dauern, bis sich diese Partizipation
als Revolutionsdividende für einen
Großteil der Jugendlichen einstellt.
Erschienen in der Afrikapost 4/12.