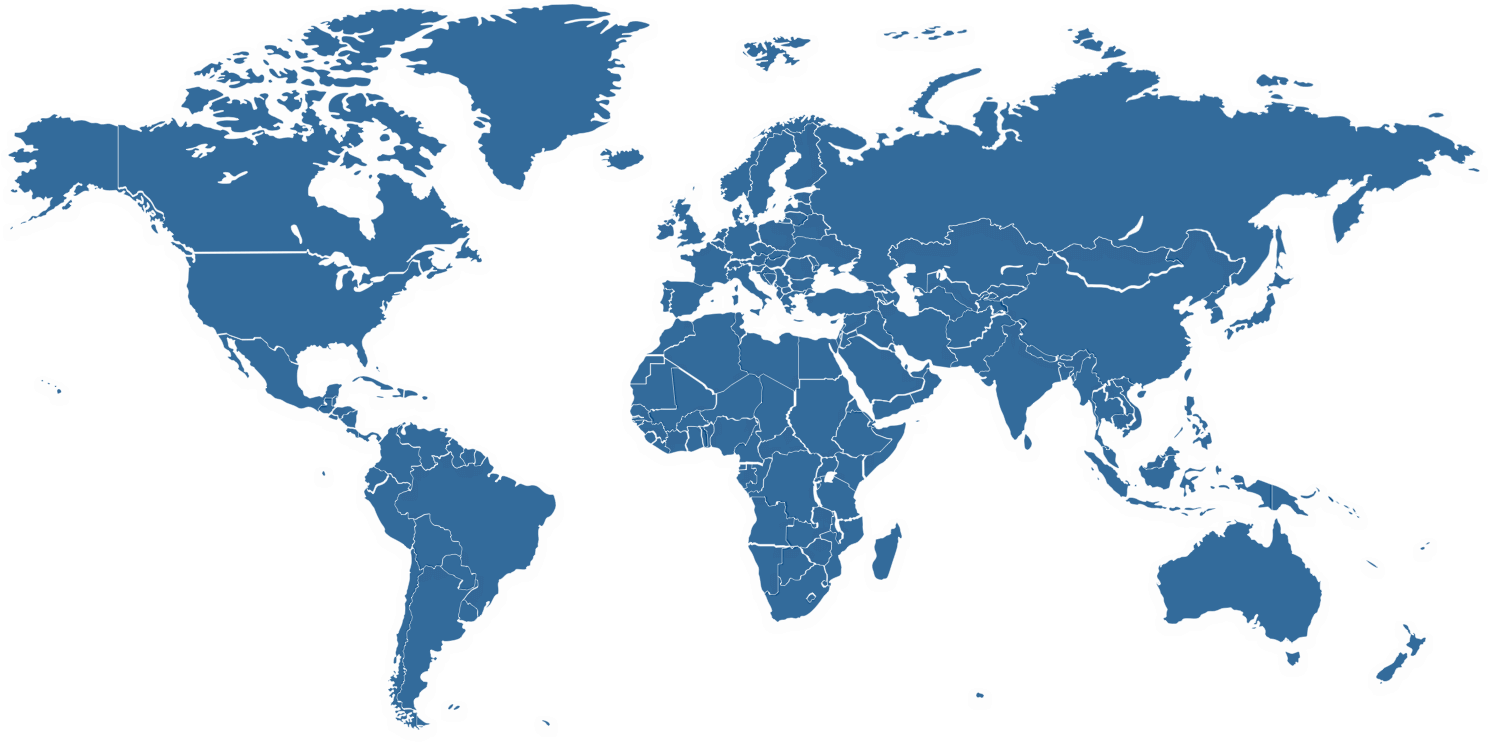Nach der Begrüßung durch die Lehrkräfte Herr Semeniuk (Oberschule Koblenzer Straße) und Frau Schneider (Gymnasium Horn) stellte Tagungsleiter Jochen Leinert die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung vor und betonte die erinnerungskulturelle Bedeutung der Ausstellung. Im Anschluss berichtete Gesine Tettenborn in einem Vortrag über ihren sportlichen Werdegang, die systematische Dopingpraxis im DDR-Leistungssport und die politischen Repressionen, denen sie und ihre Familie ausgesetzt waren.
Tettenborn wurde am 6. Oktober 1962 in Weißenfels geboren und war in den 1980er Jahren eine erfolgreiche Sprinterin für die DDR. Zu ihren größten Erfolgen zählten der Gewinn der Europameisterschaft im 4x100-Meter-Staffellauf 1982 sowie der Weltrekord über 4x400 Meter im Jahr 1984.
Besonders prägend war ihre persönliche Reflexion über das Zwangsdoping, das sie bereits im Jugendalter ohne ihr Wissen erhielt. Die daraus resultierenden körperlichen und psychischen Folgen begleiten sie bis heute. Tettenborn sprach offen über ihre innere Zerrissenheit, etwa durch die Beobachtung durch die Stasi, ihre Weigerung, in die SED einzutreten, und ihre heimliche Beziehung zu einem Schweizer Sportler. Trotz sportlicher Erfolge – etwa bei den Europameisterschaften 1982 oder dem Weltrekord 1984 –entschloss sie sich bereits mit 22 Jahren zum Karriereende, um ihrem inhaftierten Bruder durch Häftlingsfreikauf zu helfen. Ihren Wunsch zur Streichung ihrer Rekorde im Jahr 2010 erklärte sie mit ihrer Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen.
Im Anschluss an den Vortrag stellten die Schüler engagiert Fragen:
Wie wurde die Jugend in der DDR beeinflusst?
Tettenborn schilderte ein Gefühl der moralischen Überlegenheit gegenüber dem Westen, das früh vermittelt wurde. Sportliche Erfolge wurden propagandistisch genutzt, um Nationalstolz zu erzeugen - einen Stolz, den viele ehemalige DDR-Bürger bis heute mit ihren Sportlern verbinden.
Woher wusste sie, dass sie überwacht wurde?
Ihr Vater, durch Kontakte in den Westen sensibilisiert, warnte sie früh vor der Überwachung. Er riet u. a. davon ab, kritische Inhalte über das Telefon zu besprechen – ein indirekter Hinweis auf die Aktivitäten der Staatssicherheit.
Wie reagierte das Ministerium für Staatssicherheit (MfS, Stasi) auf kritisches Verhalten einzelner Bürgerinnen und Bürger?
Die Stasi reagierte auf kritisches Verhalten mit gezielter psychologischer Zermürbung. Dazu gehörten Hausdurchsuchungen, nach denen Betroffene kleine, irritierende Veränderungen in ihrer Wohnung vorfanden – etwa verschwundene Schallplatten, die später wieder auftauchten. Diese sogenannten Zersetzungsmaßnahmen, entwickelt unter Erich Mielke, sollten das Vertrauen der Menschen in ihre eigene Wahrnehmung erschüttern. Zudem wurden Karrieren behindert und das Privatleben gezielt destabilisiert, um die Betroffenen zu isolieren und mundtot zu machen.
Wusste die Bevölkerung von den Mauertoten an der innerdeutschen Grenze?
Auf die Frage, ob die Menschen in der DDR über die tödlichen Fluchtversuche an der Mauer informiert waren, lässt sich mit „größtenteils nicht“ antworten. Geschehnisse an der Grenze wurden bewusst verschleiert. Viele Menschen galten schlichtweg als „verschwunden“. Es fehlten offizielle Informationen, und Gerüchte kursierten nur im engsten Kreis. Gesine Tettenborn selbst hatte durch ihren Bruder Zugang zu etwas mehr Hintergrundwissen als die meisten anderen – ein seltenes Privileg in einem ansonsten von Informationskontrolle geprägten Staat.
Wer wurde gedopt und welche Wirkungen hatte das?
In der Nationalmannschaft wurde, wie Akten heute belegen, nahezu jeder Athlet mit Testosteronpräparaten behandelt. Diese steigerten nicht nur das Muskelwachstum und reduzierten Regenerationszeiten, sondern führten auch zu hormonellen Veränderungen - körperlich wie psychisch. Tettenborn berichtete von Persönlichkeitsveränderungen wie verminderter Empathie und gesteigertem Durchsetzungsvermögen.
Was geschah mit dem verdienten Geld?
Die Auszahlungen erfolgten bar – mit dem Hinweis, es nicht auf ein Konto zu bringen, um Steuerabzüge zu vermeiden. Tettenborn investierte das Geld in die Ausbildung ihres Mannes, dem ein Studium aus politischen Gründen verweigert worden war.
Wie unterschied sich das Lebensgefühl im Vergleich zur Bundesrepublik?
In der DDR war das Leben weitgehend vorgeplant, erklärte Tettenborn. Trotz einzelner Privilegien empfand sie das Leben dort als eintönig. Die BRD erlebte sie dagegen als Freiheit – mit all ihren Herausforderungen und Chancen.
Zum Abschluss der Veranstaltung betonte Jochen Leinert nochmals den hohen Wert von Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung. Das Gespräch mit Gesine Tettenborn verdeutlichte eindrucksvoll, wie wichtig persönliche Zeugnisse für das historische Verständnis und die politische Bildung junger Menschen sind.
Autor: Thore Bunger