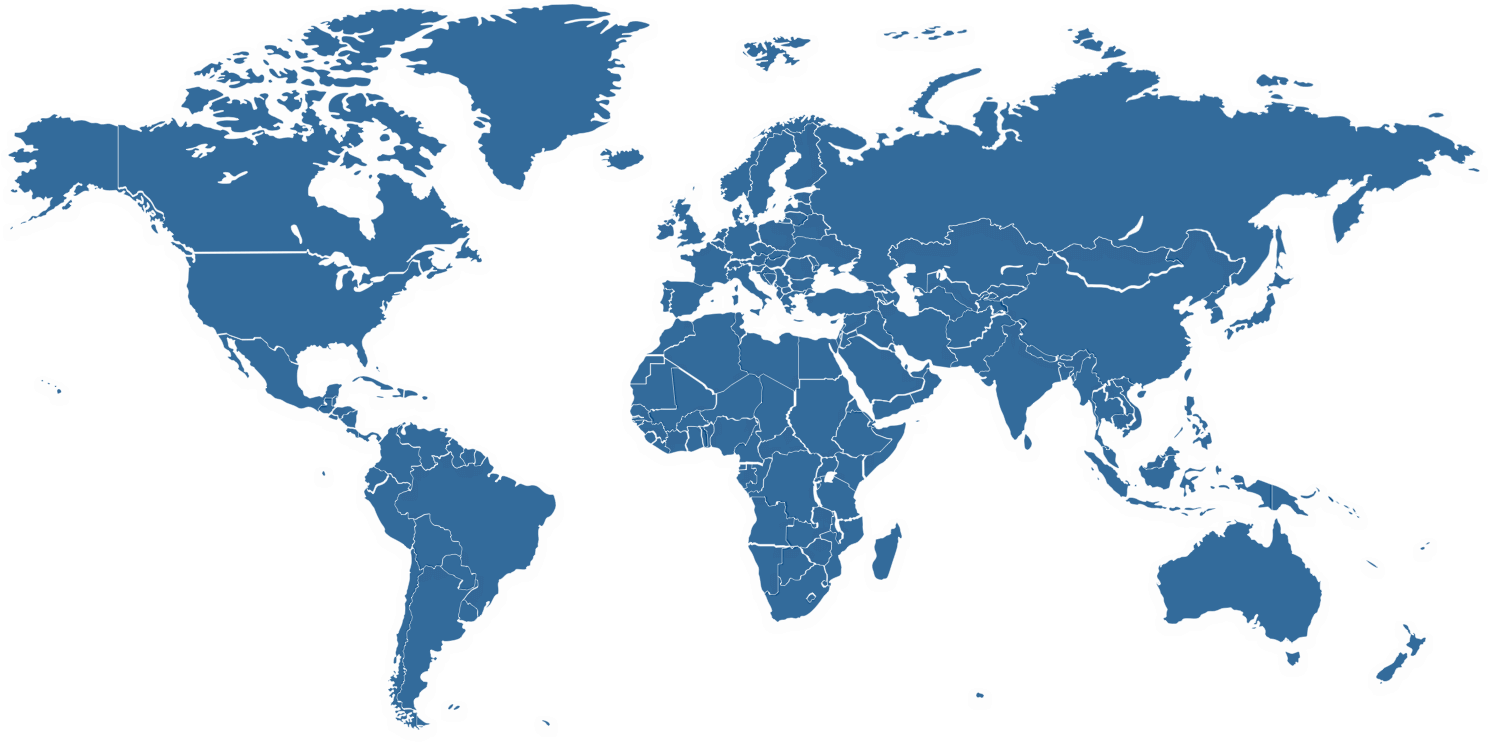Rauhes Politklima
Die Parlamentswahlen 2025 fanden in einem angespannten politischen Klima statt. Premierminister Edi Rama, der Chef der Sozialistischen Partei, genießt zwar international Anerkennung für seine außenpolitischen Initiativen, doch Albanien wurde im Vorfeld der Wahlen von Korruptionsskandalen erschüttert. Die Demokratische Partei (DP) konnte einen tiefgreifenden innerparteilichen Machtkampf zwischen dem ehemaligen Präsidenten und Ministerpräsidenten Sali Berisha und seinem einstigen politischen Ziehkind und späteren Widersacher Lulzim Basha, der sogar gerichtlich ausgetragen wurde, erst vor wenigen Monaten überwinden. Sali Berisha wurde als Parteivorsitzender bestätigt und übernahm erneut die Kontrolle über die Parteistrukturen. Die Rivalität zwischen den beiden dominierenden Parteien, der SP und der DP, und ihrer jeweiligen starken Führer prägt die albanische Geschichte seit dem Untergang des Kommunismus.
Wahlergebnisse und Wahlbeteiligung
Bei den Parlamentswahlen 2025 wurden – wie auch 2021 – insgesamt 140 Abgeordnete nach einem regionalen Listenwahlsystem für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Die Wahl erfolgte in 12 Wahlkreisen, die den Verwaltungsregionen (Qarks) Albaniens entsprechen. Die Sitzverteilung richtete sich nach der Bevölkerungszahl der jeweiligen Region. Insgesamt kandidierten 2.046 Personen, darunter 787 Frauen. Das Wahlsystem kombinierte 2025 sogenannte geschlossene und offene Listen: Ein Drittel der Mandate wurde über geschlossene Listen vergeben, bei denen die Parteiführung die Kandidaten bestimmte. Die übrigen Mandate wurden über offene Listen vergeben, bei denen Wähler Einzelpersonen direkt wählen konnten. In beiden Fällen galten gesetzliche Geschlechterquoten, um die Repräsentation von Frauen zu stärken. Einige kleinere Parteien setzten bewusst auf offene Listen, um bürgernahe Politik und innerparteiliche Transparenz zu signalisieren.Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis der Zentralen Wahlkommission waren 3.467.962 Albanerinnen und Albaner wahlberechtigt. Rund 1,5 Millionen nahmen an der Wahl teil, was einer Wahlbeteiligung von ca. 42 % entspricht – auf den ersten Blick ein Rückgang im Vergleich zu 2021, als die Beteiligung bereits bei niedrigen 46,32 % lag. Allerdings ist diese Zahl irreführend, da über ein Drittel der registrierten Wähler im Ausland lebt, viele davon dauerhaft. Bezogen auf die in Albanien ansässige Bevölkerung lag die tatsächliche Wahlbeteiligung 2025 bei über 75 % – ein im regionalen Vergleich beachtlicher Wert.
Die regierende Sozialistische Partei (SP) ging auch 2025 als klare Siegerin aus den Wahlen hervor. Sie erhielt 776.504 Stimmen, was einem Stimmenanteil von 52,26 % entspricht. Damit konnte die SP ihr Ergebnis von 2021 (48,67 %) deutlich ausbauen und ihre Sitzzahl von 74 auf 83 erhöhen – erneut eine absolute Mehrheit (erforderlich: 71 Sitze). Die oppositionelle Demokratische Partei – Allianz für ein Großartiges Albanien (DP-ASHM), ein Zusammenschluss aus der Demokratischen Partei unter der Führung von Sali Berisha und 23 Kleinstparteien, erhielt 504.360 Stimmen (33,95 %) und errang 50 Mandate. Damit verlor die DP gegenüber 2021 (39,43 % und 59 Sitze) an Stimmen und Mandaten. Die Sozialdemokratische Partei (PSD), die bereits in der letzten Wahlperiode im Parlament vertreten war, erzielte 48.382 Stimmen (3,26 %) und erhielt drei Mandate – gleich viele wie 2021. Die neue Partei „Mundësia“ erreichte 45.837 Stimmen (3,09 %) und zieht mit zwei Abgeordneten erstmals ins Parlament ein. Auch die Initiativen „Gemeinsam“ und „Albanien wird“ sind jeweils mit einem Sitz im neuen Parlament vertreten.
Parteienlandschaft und Akteure
Die politische Landschaft Albaniens bleibt damit weiterhin von zwei großen Parteien geprägt. Die Sozialistische Partei wurde 1991 als Nachfolgeorganisation der ehemaligen Kommunistischen Partei gegründet. Die SP ist seit 2013 ununterbrochen an der Regierung und versteht sich als sozialdemokratische Kraft mit marktwirtschaftlicher Ausrichtung. Premierminister Edi Rama prägt die politische Kultur durch seinen personalisierten Führungsstil sowie eine strategische Nutzung sozialer Medien und internationaler Netzwerke. Die Demokratische Partei entstand 1990 als erste Oppositionspartei nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Einparteiensystems und wurde in den 1990er-Jahren zur zentralen Trägerin des politischen Wandels. Sie versteht sich als konservative und wirtschaftsliberale Partei. Sie führte die Regierung zwischen 1992 und 1997 sowie von 2005 bis 2013.
Da in der albanischen Gesellschaft ein gewisser Ermüdungsprozess in Bezug auf die politischen Akteure, die diese beiden Parteien seit vielen Jahren führen, eingesetzt hat, wird man im neuen Parlament das Agieren von drei Parteien, die noch nie vertreten gewesen sind, mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen. Sie stellen teils bewusste Brüche mit den etablierten Lagern dar. Die Partei Mundësia („Möglichkeit“) wurde im Jahr 2024 vom Unternehmer und ehemaligen DP-Abgeordneten Agron Shehaj gegründet. Die Mitte-Rechts-Partei stellt programmatisch die wirtschaftliche Entwicklung, individuelle Freiheit und den Schutz traditioneller Werte in den Vordergrund. Shehaj wurde u. a. durch die von ihm unterstützte historische Aufarbeitungsplattform Kujto.al bekannt.
Die Bewegung „Lëvizja Bashkë“ („Bewegung Gemeinsam“) ist eine 2022 gegründete linkssozialistische Partei. Parteichef Arlind Qori trat bei der Kommunalwahl 2023 als Bürgermeisterkandidat in Tirana an und erreichte dort 4,77 %. Die zentristisch ausgerichtete Initiative „Thurje“ entstand 2018 aus Studentenprotesten und setzt auf Antikorruptionspolitik und die Rückführung illegalen Vermögens. Sie trat gemeinsam mit der neuen „Initiative Shqipëria bëhet“ („Albanien wird“) zur Wahl an.
Wahlkampf zwischen EU-Vision und Polarisierung
Der Wahlkampf wurde von der Personalisierung politischer Kommunikation geprägt. Premierminister Edi Rama inszenierte sich als Garant für Stabilität und pro-europäischen Fortschritt. Sein Versprechen einer „europäischen Staatsbürgerschaft bis 2027“ war ein zentrales Narrativ. Rama war omnipräsent; er präsentierte sich selbst als unersetzlichen Motor für die europäische Zukunft Albaniens. Die Opposition unter Sali Berisha hingegen, inspiriert von Donald Trumps Wahlkampagne, präsentierte sich mit Sali Berisha als Verteidiger eines „großartigen Albaniens“, sprach von moralischem Verfall und inszenierte sich als Kämpfer gegen das „System Rama“. Die Anlehnung an Trumps „Make America Great Again“-Rhetorik war durch die Verwendung des Slogans „Make Albania Great Again“ unverkennbar. Den Wahlkampf dominierten persönliche Angriffe, symbolische Inszenierungen und ein Schlagabtausch auf emotionaler Ebene.
Internationale Beobachter
Der Wahltag selbst verlief insgesamt geordnet. In allen Wahllokalen kam das neue System zur biometrischen Identifikation der Wähler zum Einsatz, was von den Wahlbeobachtern der OSZE/ODIHR, des Europarats und des Europäischen Parlaments grundsätzlich positiv bewertet wurde. Trotz eines Lobes für die professionelle Organisation wurden von der internationalen Beobachtungsmission jedoch mehrere strukturelle Defizite festgestellt. Insbesondere der weit verbreitete Missbrauch öffentlicher Ressourcen durch die Regierungspartei – etwa durch die Koppelung offizieller Veranstaltungen mit Wahlkampfinhalten und die Ankündigung sozialpolitischer Maßnahmen kurz vor der Wahl – verschaffte der SP einen unverhältnismäßigen Vorteil. Auch wurden Fälle von Einschüchterung, Druck auf öffentliche Angestellte und unfaire Einflussnahme auf Wähler dokumentiert. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob Sali Berishas Aufrufe zu Protesten gegen den Wahlausgang Erfolg haben werden. Die Sozialistische Partei dürfte trotz wachsender Kritik der dominierende Machtfaktor in Albanien bleiben. Ihr Wahlsieg bringt kurzfristig politische Stabilität mit sich, wirft jedoch auch Fragen zur augenblicklichen demokratischen Qualität des politischen Systems auf. Dennoch dürfte Albanien seinen Weg in die Europäische Union fortsetzen.