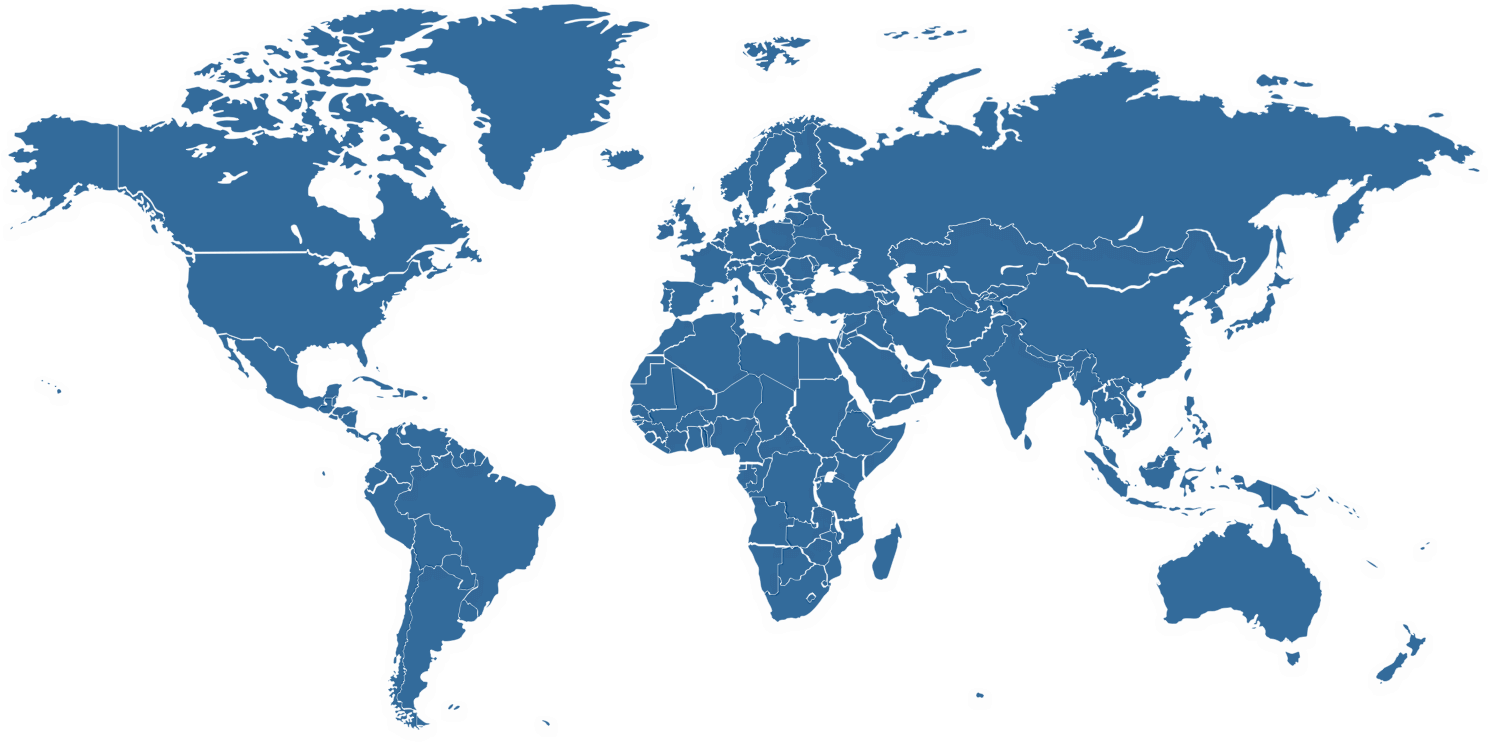Die Objektive der internationalen Medien richten sich ab Mittwoch auf den wohl berühmtesten Schornstein der Welt. Wer wird nach dem „Habemus Papam“ auf die Mittel-Loggia des Petersdomes treten und den ersten Segen „Urbi et Orbi“ erteilen? Wer irgendwelche Zweifel hegt, ob Katholische Kirche und Papsttum auch im Jahre 2025 noch eine universelle Relevanz haben, der mag sich in diesen Tagen den unvorstellbaren Medienrummel in der Ewigen Stadt betrachten. Für die wahlberechtigten Kardinäle gilt es indes, Programmatik und Person zusammenzuführen. Dabei verläuft vieles anders, als man es sich gemeinhin vorstellt. In der vorliegenden Analyse werden die Schlüsselthemen des künftigen Pontifikats dargelegt und überlegt, welche Persönlichkeiten dafür stehen könnten.
Zwei Tage lang blieben die Meldungen, die in internationalen Agenturen und auf katholischen Websites die Runde machten, ohne Dementi stehen. Erst als die mediale Gerüchteküche überzukochen drohte, griff Vatikan-Sprecher Matteo Bruni ein: Nein, Pietro Parolin, Kardinalstaatssekretär unter dem verstorbenen Papst Franziskus, habe keinen Kreislaufkollaps erlitten; er sei auch nicht ohnmächtig geworden. Auch habe das bereitstehende medizinische Personal keinen Einsatz vermeldet. Doch ob es sich nun um Fake News handelt oder nicht: Die Nachricht war in der Welt und vermittelt, dass der bisherige „Papabile Nummer Eins“ unter gesundheitlichen Problemen leidet.
Bei der fragwürdigen Nachricht handelt es sich um eine beliebte Methode, einen aussichtsreichen Kandidaten zu verhindern. Der Vorgang zeigt: Vor einer Papstwahl kann es ähnlich zugehen wie in der Politik. Da werden die Medien angefüttert, Gerüchte verbreitet, Aussagen über die Bande gespielt, Bataillone in Stellung gebracht, Personen positioniert, Informationen durchgestochen, Intrigen gesponnen. Um klarzustellen: Mitnichten immer aus dem Kreis der Purpurträger.
Hauptsächlich sind es die innerkirchlichen Lobbygruppen, die bestimmte Kandidaturen befördern oder verhindern wollen. Bei denen handelt es sich oftmals um international einflussreiche Laienverbände wie die Fokolar-Bewegung, die Gemeinschaft von Sant’Egidio oder den Neokatechumenalen Weg. Dann Orden und geistliche Gemeinschaften, wie etwa Jesuiten und Salesianer. Aber auch lockere Zusammenschlüsse aus Laien, Fachmedien und Klerikern, die sich einem bestimmten Thema verpflichtet fühlen; wie zum Beispiel der Verteidigung des vorkonziliaren Messritus auf Seiten der Konservativen, oder der Öffnung des Pflicht-Zölibates für verheiratete Männer („viri probati“) auf Seiten der Reformer. Manchmal sind es auch Staaten mit handfesten politischen Interessen, die im Hintergrund genehme Kandidaten befördern wollen, von denen sie sich Wohlwollen oder die Verstärkung ihrer eigenen Soft-Power erhoffen. All diese Einflussversuche werden heutzutage mitunter medial angeheizt und von professionellen Lobby-Methoden flankiert.
Gesucht: Kandidat mit Integrationskraft
Auch wenn es die Kardinäle bei jedem Interview im Vorfeld pflichtschuldig dementieren: Selbstverständlich gibt es in ihrem Kollegium Fraktionen: von moderaten Konservativen und Liberalen bis hin zu echten Traditionalisten und radikalen Reformern. „Lagerdenken ist auch dem Kardinalskollegium nicht fremd“, urteilte freimütig der deutsche Kurienkardinal Gerhard Ludwig Müller. Dazu kommen all die Unterschiede aus den verschiedensten kulturellen, mentalen und sozialen Ausprägungen einer Weltkirche mit ihren 1,4 Milliarden Katholiken aus sämtlichen Teilen des Erdkreises.
Man fragt sich unwillkürlich: Wie soll das alles zusammengehen? Wie soll man einen inhaltlichen Konsens finden? Und schon gar einen Pontifex, der diese bereichernde, aber zugleich hochkomplexe Vielfalt zusammenhalten kann? Doch genau darum geht ab diesem Mittwoch, wenn sich die Tore der Sixtinischen Kapelle nach der berühmten Formel „Extra Omnes“ (Alle hinaus) hinter den Kardinälen schließen. Wem wollen sie diese Mammut-Aufgabe auf die Schultern legen? Oder besser: Wem wollen sie das antun?
Die kleine Sakristei gleich neben Michelangelos Jüngstem Gericht wird nicht umsonst als „Kammer der Tränen“ bezeichnet. Hier habe schon manch ein frisch gewählter Pontifex, beim Umkleiden in die weißen Papst-Gewänder, bittere Tränen vergossen, weil ihm die Schuhe des Fischers ein paar Nummern zu groß schienen. „Gott vergebe Euch, was Ihr mir angetan habt“, soll der frisch gekürte Johannes Paul II. seinen Mitbrüdern zugerufen haben. Ob es scherzhaft gemeint war oder ob er ebenfalls Furcht empfand – ihm passten die Schuhe perfekt.
Doch bevor es um die Wahl der geeigneten Person geht, stehen die Themen der Zeit und die damit verbundenen Herausforderungen des künftigen Pontifikats im Vordergrund der Diskussionen. Manchmal müssen die Purpurträger dabei in die Glaskugel blicken; manchmal jedoch liegen die Themen auf der Hand. Letzteres gilt für die Papstwahl 2025. Schon das globale Umfeld macht deutlich, was auf das neue Oberhaupt der Katholischen Kirche politisch und diplomatisch zukommt. Eine Welt voller Krisen, Konflikte und Kriege, bei der man nicht mehr weiß, welche Lunten man zuerst austreten soll. Eine Welt, in der statt der „Stärke des Rechts“ wieder das „Recht des Stärkeren“ zu gelten scheint, in der Frieden, Freiheit und Menschenrechte global so bedroht sind wie seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr.
Dazu die dramatischen Folgen des Klimawandels, Massen-Migration, Flucht, soziale Verelendung. Dazu kommt in manchen Weltregionen ein religiös und politisch aufgeladener Hass, der ausgerechnet die Christen zur inzwischen meistverfolgten Religionsgruppe weltweit macht. Dies ausgerechnet vor dem Hintergrund einer durch die neue Welle der Säkularisierung oftmals indifferenten westlichen Gesellschaft, die bei diesem Thema allzu häufig lieber wegschaut. Dazu kommen die Expansionsgelüste Moskaus, Pekings und neuerdings Washingtons.
Politische Erfahrung von Vorteil
Wie geht man damit um? Wo ist mit stiller vatikanischer Diplomatie mehr zu erreichen, wo sind öffentliche Mahnungen des Papstes notwendig? Wo baut man besser Brücken, wem hält man lieber das Kruzifix vor die Nase? Ein möglicher Kandidat, dem dies zuzutrauen wurde, ist der Lateinische Patriarch von Jerusalem, der Franziskaner Pierbattista Pizzaballa. Wer sich im Minenfeld des Heiligen Landes zu bewegen weiß, der könnte dies auch auf internationaler Ebene. Ein Vatikanist fasste es so zusammen: „Wer Jerusalem kann, der kann auch Rom“. In der Tat steht der 60-jährige Italiener aus Bergamo inzwischen weit oben auf der Liste der möglichen Nachfolger Petri. Als Mann der franziskanischen Ideale würde er Kontinuität zur Vergangenheit garantieren; theologisch gilt er zugleich als konservativer als Franziskus, was ihm durchaus helfen könnte, die innerkirchlichen Flügel zu versöhnen.
Dazu kommt der weite Spannungsbogen der innerkirchlichen Themen und Debatten: Da ist der Dauerbrenner von sexualisiertem Missbrauch, dem Umgang mit Opfern und Tätern und die mancherorts noch immer mangelhafte weltweite Implementierung der strikten Richtlinien, die Franziskus erlassen hatte. Da ist die Positionierung der Kirche zum Thema Künstliche Intelligenz; gereicht sie zum Segen oder zum Fluch der Menschheit? Welche Auswirkungen hat sie auf die Menschenwürde und das Recht auf Arbeit? Das gleiche gilt für die Quantensprünge in der Gentechnik. Die Päpstliche Akademie der Wissenschaften beschäftigt sich damit intensiv unter ihrem Kanzler Peter Turkson (76 Jahre), dem aus Ghana stammenden Kardinal, dem beim Konklave zumindest eine Außenseiter-Chance eingeräumt wird.
Welche Vision für die Zukunft der Kirche?
Da ist das Ringen um das richtige Verständnis von Synodalität, das vom Vatikan strukturell und theologisch anders interpretiert wird als beispielsweise von der deutschen Kirche; von Teilkirchen in manch anderen Weltregionen gar rundweg abgelehnt wird. Wieviel Mitsprache verträgt eine Kirche, die sich in ihrem Wesen auf die göttliche Offenbarung beruft, ohne dass diese in „Parlamentarismus“ ausartet? Wie sichert man die Weitergabe des Glaubensschatzes an künftige Generationen ab, wenn sich vielerorts in der westlichen Welt die Eltern von der Kirche verabschiedet haben? Inwieweit soll sich die Kirche pastoral und in der Lehre an vorherrschende gesellschaftliche Strömungen anpassen? Die Wahrheit mag irgendwo in der Mitte liegen, denn: „Pastoral ohne Lehre führt zu Beliebigkeit – Dogmatismus ohne Pastoral hingegen zu Unbarmherzigkeit“, wie es der Münchner Kardinal Reinhard Marx vor Jahren definierte.
Ein Kardinal, der für diesen Mittelweg stehen könnte, ist der bisherige Generalsekretär der Weltsynode, der aus Malta stammende, 68 Jahre alte Mario Grech. In seiner Funktion musste er genau das tun: Austarieren, ausbalancieren, die Einen mitnehmen, die Anderen nicht vor den Kopf stoßen. Gräben zuschütten, Brücken bauen. Dabei dennoch nicht das große Ziel aus den Augen verlieren: Der gemeinsame Aufbruch der Weltkirche in die Realitäten der Zukunft. Ihm wäre dieser Spagat, der eine Menge Integrationskraft erfordert, zuzutrauen. Das hat er in den vergangenen Jahren bewiesen, zudem ist er durch sein Amt gut bekannt. Sein Name ist seit einigen Tagen immer öfters rund um den Vatikan zu vernehmen.
Kriterium körperliche Konstitution
Es gilt also in erster Linie, Thema und Person zusammenzuführen. Aber sind die Vorstellungen vom Prozess der Meinungsbildung unter den Kardinälen tatsächlich so, wie sie von den Medien kolportiert werden? Ein französischer Papst-Wähler plauderte dazu erstaunlich offen aus dem Nähkästchen: „Vom ersten Abend des Konklaves an haben wir eine klare Vorstellung von der Verteilung der Stimmen, was von grundlegender Bedeutung ist“, erläuterte Kardinal Philippe Barbarin, der bereits 2005 und 2013 am Konklave teilnahm. „Das ist ein Moment der Wahrheit: Vor dem Konklave behaupten die Medien, alles zu wissen, wissen aber nichts; ab dem Abend des ersten Tages des Konklaves wissen wir genau, wohin die Stimmen gehen, während die Journalisten im Dunkeln tappen.“ Zum Alter des künftigen Papstes führte der Kardinal aus: „Ich persönlich neige, obwohl ich mich irren könnte, zu der Annahme, dass wir eher jemanden wählen werden, der jünger als 70 Jahre ist. Die Kirche steht vor großen Herausforderungen, die wahrscheinlich ein Pontifikat von einiger Dauer erfordern werden, um eine kohärente Vision umzusetzen.“
Tatsächlich könnte Barbarin, ehemals Erzbischof von Lyon, damit eine Mehrheitsmeinung unter den Kardinälen wiedergeben. Das Petrus-Amt erfordert angesichts der heute erwarteten medialen Dauer-Präsenz und der anstrengenden Reisen eine fitte körperliche Konstitution. Ein Papst, der schon nach ein paar Jahren im Rollstuhl sitzt, das will man wohl vermeiden. Ob am Ende ein bekannter Kardinal als neuer Papst auf die Mittel-Loggia des Petersdoms tritt oder doch ein Überraschungskandidat – es gilt der uralte Spruch der Römer: „Wer in Weiß ins Konklave einzieht, kommt meist in Rot wieder heraus.“ Und der Heilige Geist hat bekanntlich auch ein Wörtchen mitzureden. Der weiße Rauch wird bald aufsteigen.