
Lebensmittel – hochpolitisch!
Ernährung, Lebensmittelpreise, internationale Politik, Sicherheit, Klima, Handel und gesellschaftliche Dynamiken sind eng miteinander verknüpft. Lebensmittel sind weit mehr als Waren – sie sind auch politisches, soziales, kulturelles, geopolitisches und wirtschaftliches Machtgut.
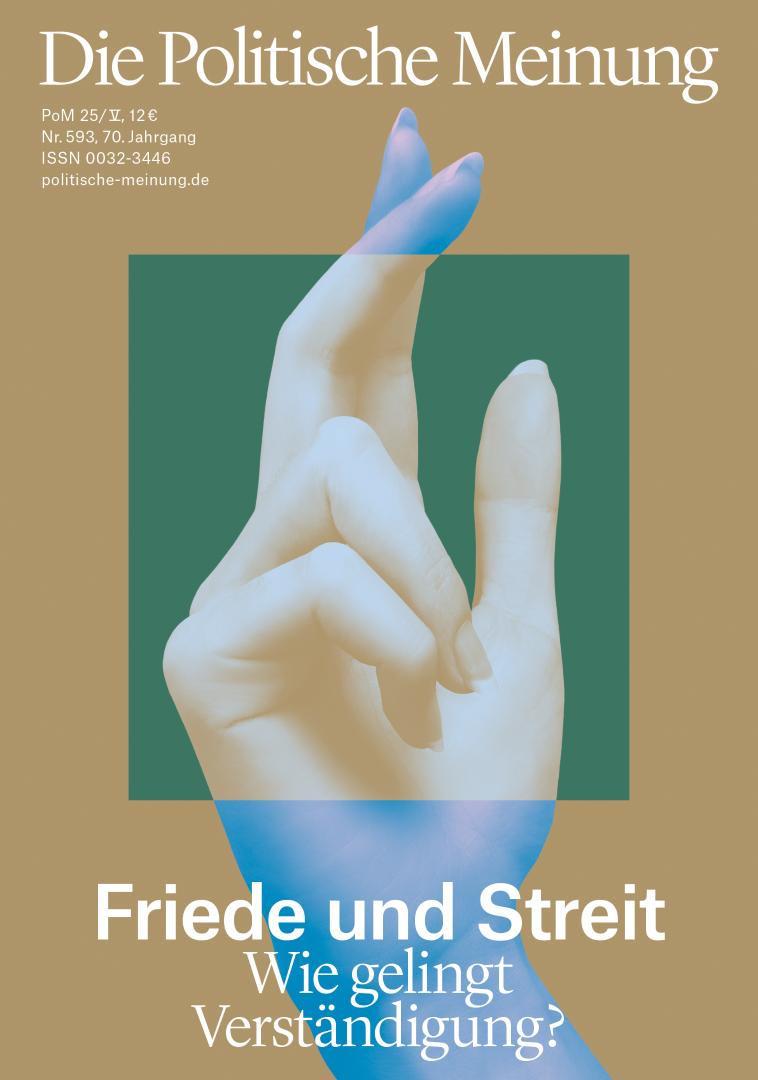
Friede und Streit – wie gelingt Verständigung?
Die hiesige Polarisierungsdebatte zeigt, dass das Verhältnis zwischen Friede und Streit gestört ist. Unsere aktuelle Ausgabe widmet sich daher der Frage, wie die Balance wiederhergestellt werden kann. Das Ziel ist nicht Pazifizierung, sondern eine konstruktive Auseinandersetzung in Friede und Streit.

TikTok – prekäre Plattform
Globales Machtinstrument und kulturelles Phänomen? Beiträge von Expertinnen und Experten aus Politik, Wissenschaft und Journalismus erläutern, warum TikTok längst nicht mehr nur eine reine Unterhaltungsplattform ist.

Industrie – ein Abgesang?
Droht Deutschland eine Deindustrialisierung – oder kann die Industrie durch Innovation, politische Weichenstellungen und internationale Kooperationen neu erstarken? Eine multiperspektivische Analyse der industriellen Lage Deutschlands und Europas und ein Plädoyer für eine strategische, innovationsfreundliche und geopolitisch wachsame Industriepolitik – jenseits von Alarmismus, aber mit klarem Handlungsauftrag.

Deutschland – offene Baustellen
Die Politik der letzten Jahre ist den zentralen Defiziten und Krisen nur zögernd begegnet und hat ihren Aktionismus auf Nebenschauplätze gelenkt. Eine Problembeschreibung der Herausforderungen, die in Deutschland mit Blick auf die neue Legislaturperiode in den verschiedenen Politikfeldern gemeistert werden müssen.

Die USA – und der Rest der Welt
Am 5. November 2024 wurde Donald Trump zum zweiten Mal zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Und wieder herrschte Unverständnis: Wie konnten die Wähler nur? Unsere Themenausgabe befasst sich zum einen mit den Auswirkungen der Wahlergebnisse auf die internationalen Beziehungen, nimmt zum anderen aber auch einen Blick in das Land, um zu verstehen, warum die US-amerikanische Gesellschaft so gespalten ist.
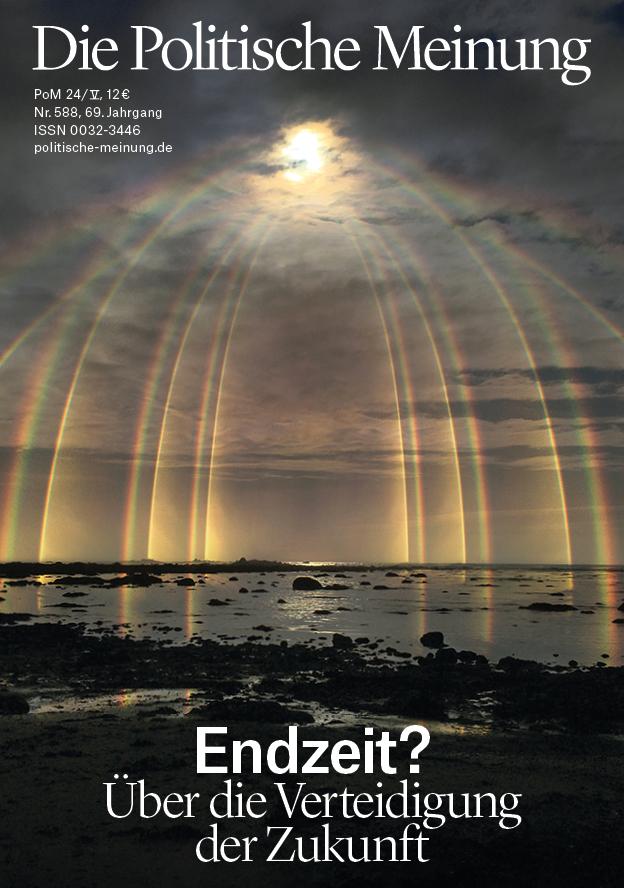
Endzeit? Über die Verteidigung der Zukunft
Der Bruch der Ampelkoalition in Deutschland und der Wahlsieg von Donald Trump in den USA haben zu einer Stimmung geführt, die von apokalyptischen Deutungen geprägt ist. Bedrohungsgefühle führen oft zu apokalyptischen Weltbildern, die politisch mobilisierend wirken können. Die moderaten politischen Kräfte haben bislang kein wirksames Rezept gegen die Vehemenz negativer Erwartungen entwickelt und neigen dazu, Probleme als zu komplex darzustellen. Diese Haltung ist nicht zuletzt mit Blick auf die jüngere Generation, die sich um ihre Zukunft sorgt, nicht zielführend. Wir gehen daher der Frage nach, warum nicht allein die Abfederung des Abstiegs, sondern Aufbruch das Ziel zur Verteidigung der Zukunft sein muss.

Künstliche Intelligenz – politische und gesellschaftliche Folgen
Ausgerechnet Protagonisten der digitalen Revolution warnen vor den Gefahren von Künstlicher Intelligenz. Ist dies nur ein billiger PR-Gag? Von Weltrettung bis Weltuntergang reichen die Hoffnungen und Befürchtungen. Wie lässt sich – jenseits von Euphorie und Panikmache – mit dieser Technologie umgehen? Wir diskutieren aktuelle gesellschaftliche Veränderungen unter dem Einfluss von KI und sucht nach ebenso technologieoffenen wie kritischen Ansätzen zum positiven Gebrauch einer fraglos disruptiv wirkenden Innovation.

„Osten“ – Räume, Risiken, Ressentiments
Das Thema „Osten“ ist angesichts des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine hoch aktuell. Bei der Chiffre „Osten“ schwingt nicht selten der pauschale Vorwurf wirtschaftlicher Rückständigkeit und demokratischer Unreife mit. Welche Vorstellung von „Osteuropa“ gibt es heute, was wird unter „Osten“ mit Blick auf verschiedene Wahrnehmungen verstanden und was bedeuten diese Wahrnehmungen für das europäische Selbstverständnis konkret?
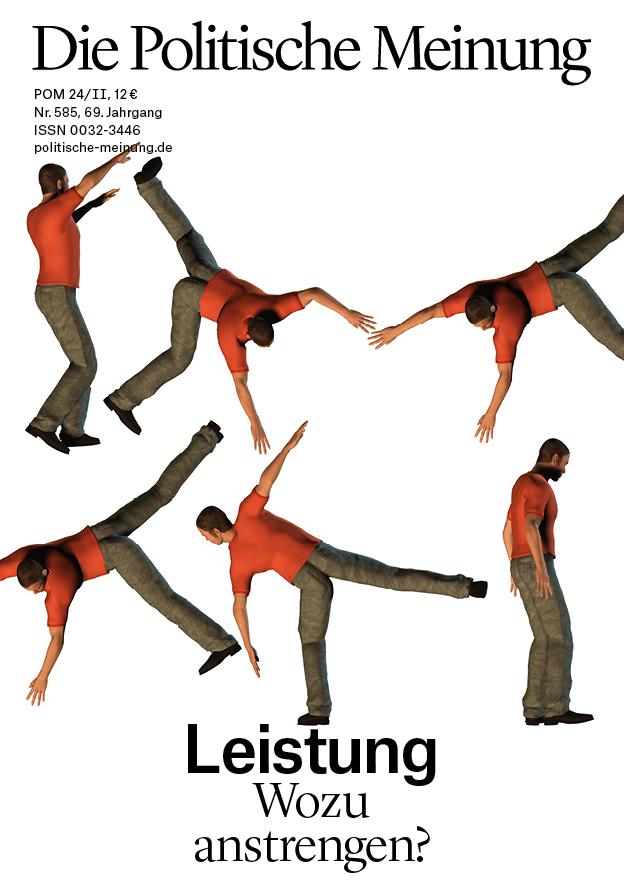
Leistung – wozu anstrengen?
Burnout-Deutschland: Allenthalben mehren sich die Zeichen kollektiver Zerknirschtheit. Landwirte im Aufstand. Unternehmen investieren woanders; die deutsche Tech-Szene trifft sich in Palo Alto. Die Frage, die nach dem Zweiten Weltkrieg am Anfang der Sozialen Marktwirtschaft stand, stellt sich heute neu: wozu anstrengen? Im Leistungsprinzip fand man damals den Zündmechanismus, um ungeahnte Energien freizusetzen. Nun hat das Thema „Leistung“ hat durch den internationalen Wettbewerb, die schlechten Konjunkturaussichten Deutschlands, den demografischen Wandel und die Debatten über die Zukunft der Arbeit erneut an Relevanz gewonnen. Leistung reloaded – kann das der Booster aus der Erstarrungsmisere sein?


