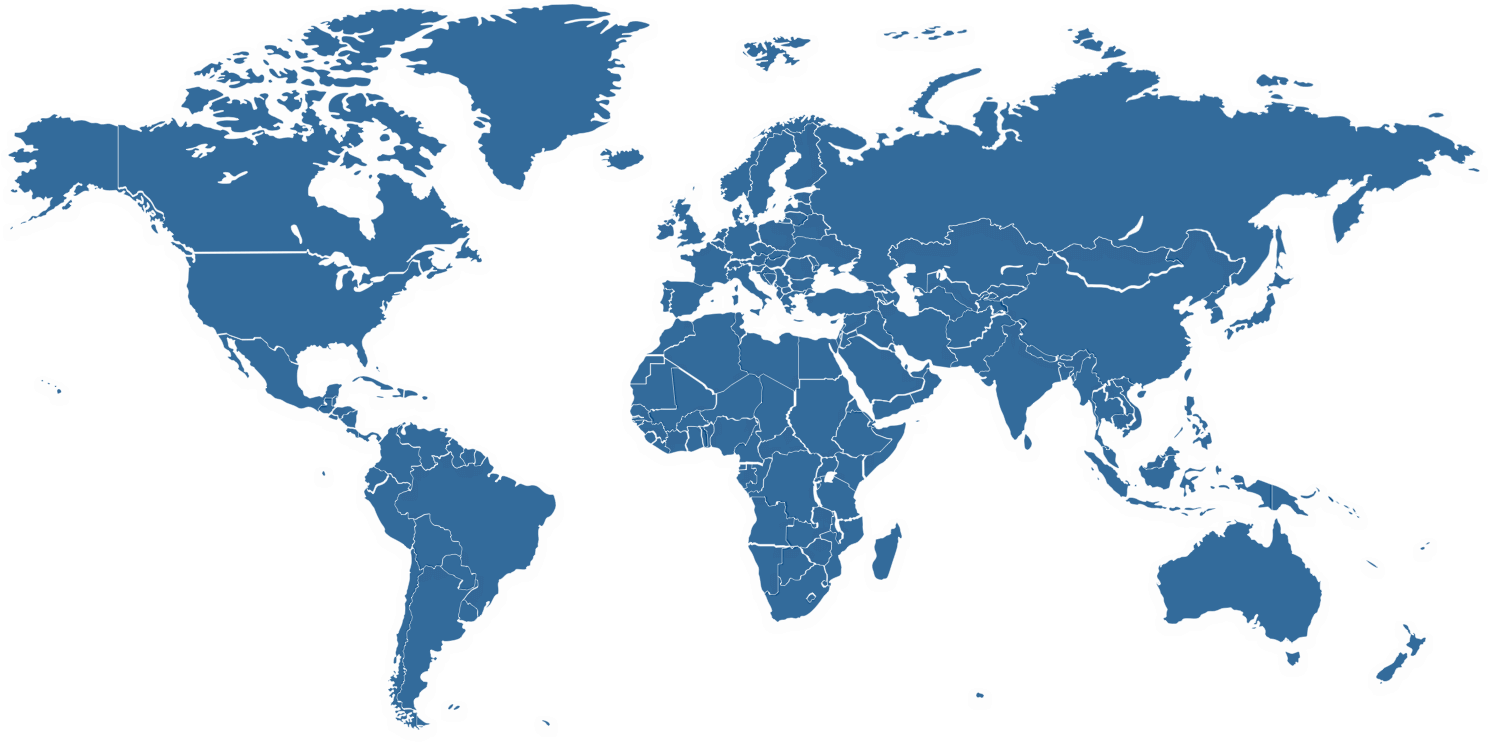Nach Begrüßung und inhaltlicher Einführung durch Felix Kraft folgte eine allgemeine Vorstellungsrunde sowie im Anschluss die Filmdokumentation „Ferien ohne Urlaub: Politische Entscheidungen Adenauers in Cadenabbia“, die den historischen Wert des Tagungsortes herausstrich und gleichzeitig auf den Stadtrundgang mit Lucia Pini vorbereitete, der den ersten Tag gewinnend abrundete. Mehr zur Villa la Collina, ihrer Geschichte und ihrem berühmten Teilzeitmieter erläuterte Heiner Enterich am nächsten Tag.
Zum Einstieg in das Seminarthema analysierte Dr. habil. Landry Charrier als erstes in einer vorläufigen Bilanz die Regierungszeit Emmanuel Macrons im Hinblick auf die deutsch-französischen Beziehungen. Das bilaterale Verhältnis ließe sich aus französischer Sicht in vier Phasen unterteilen:
Erstens: Die „Umgarnungsphase“ (Januar 2017 – Frühling 2019).
Zweitens: „Die Zeit der fruchtbaren Konfrontation“ (2019-2021).
Drittens: „Verpasste Chancen“ (2022 bis 2025).
Viertens: „Signale des Einvernehmens“ (seit 2025).
Die erste Periode sei von Macrons Ziel geprägt gewesen, den deutsch-französischen Bilateralismus als Motor Europas wiederzubeleben, was bereits durch zwei Wahlkampfauftritte in Deutschland und insbesondere bei seiner Rede an der Berliner Humboldt-Universität im Januar 2017 deutlich geworden sei. Nach seiner Wahl gelte sein Auftritt vor dem Deutschen Bundestag im November 2018 als Meilenstein seiner Bemühungen.
In Phase zwei wiederum hätten Frust und Ärger über Deutschland dominiert, das die französischen Bemühungen und Initiativen unbeantwortet gelassen habe. Stattdessen sei der Ausbau der Beziehungen zu kleineren Staaten wie den Niederlanden und die Reaktivierung alter Kooperationen (Mittelmeerstaaten, Polen) vorangetrieben worden. Themenbezogene Allianzen sollten Deutschland unter Zugzwang setzen und so über Umwege „an Bord holen“. Diese Alleingänge hätten in der Konsequenz zu „strategischer Einsamkeit“ geführt, die allerdings aus dem Vakuum resultierten, das die deutsche Zögerlichkeit habe entstehen lassen. Aus deutscher Sicht sei Macron wiederum „vom Heilsbringer zum Störenfried“ geworden.
Mit den Wahlen 2022, bei denen Deutschland nur noch bei den Extremisten links und rechts eine Rolle gespielt habe, habe der dritte Abschnitt begonnen. Im Oktober/November 2022 sei ein Bruch zwischen Deutschland und Frankreich möglich gewesen, doch am Ende markierte der Streit den Beginn einer Annäherung in strategischen Fragen (Russland, China, EU-Erweiterung). Aber aus der Vernunftehe der 1950/60er Jahre habe sich eine Zwangsehe entwickelt. Im Zuge des 60. Jahrestages des Élysée-Vertrags („Regierungsklausur“) habe man sich um neue Formate der Zusammenarbeit bemüht. „Dass es knirscht und kracht zwischen Deutschland und Frankreich, es aber nie zum Bruch kommt, ist eine Konstante der Geschichte.“ Kanzler Scholz sei wenig an Frankreich interessiert gewesen und habe dort mit seinem Zögern und Zaudern irritiert; andersherum habe Macron den Nachbarn häufig mit seinen Initiativen überfordert.
Das aktuelle Stadium seit der Bundestagswahl 2025 habe indes vielversprechend begonnen, nach der Entfremdung scheine ein Neuanfang möglich – insbesondere pflegten Merz und Macron einen ähnlichen Politikstil und wiesen in ihren Persönlichkeiten Gemeinsamkeiten auf. Eine gemeinsame Führung in der EU in Zeiten globaler Herausforderungen sei wichtiger denn je. Es müsse verstanden (und akzeptiert) werden, dass Deutsche und Franzosen „anders tickten“, und dass gerade daraus eine Dynamik zu erzielen sei.
Was in der vorangegangenen Einheit bereits anklang, wurde im Folgenden vertieft: die Sicherheitsstrategien Frankreichs und Deutschlands im Vergleich (Kontinuitäten, Bruchlinien, Anschlussmöglichkeiten). Dr. Hans-Dieter Heumann hob zunächst hervor, dass die im Juli 2023 verabschiedete nationale Sicherheitsstrategie die erste einer Bundesregierung überhaupt gewesen sei und man durchaus geneigt sei, das Wort vom „Krieg als Vater aller Dinge“ zu bemühen. Dies sei angesichts neuer Bedrohungen und Machtzentren (nicht nur China als „Wettbewerber und systemischer Rivale“, sondern z.B. auch Saudi-Arabien) auch dringend erforderlich gewesen. Frankreich hingegen habe immer schon strategisch gedacht, während sich in Deutschland die Außenpolitik stets dem Primat der Innenpolitik zu beugen habe. Doch nun seien auch Lieferketten sicherheits- und machtpolitisch relevant geworden.
Dr. habil. Landry Charrier erklärte, dass im Gegensatz zu Deutschland Frankreich eine lange Tradition bei Sicherheitsstrategiepapieren habe. Die erste stamme aus dem Jahr 1972. Aktuell müsse man von „2 + 1 Sicherheitsstrategien“ sprechen, denn die erste unter Macron sei 2017 verabschiedet und 2021 aktualisiert und 2022 sei eine neue aufgesetzt worden. Der Wandel der Weltordnung solle aktiv beeinflusst werden, denn Frankreich sehe sich dem Selbstverständnis nach als eine „Mittelmacht mit globalen Ambitionen und besonderen Attributen“ (Overseas-Gebiete inklusive ihrer Wirtschaftszonen, insbesondere im Indopazifik). Frankreich habe den globalen Blick und stehe „unter Zugzwang“. Die Denkweise sei konzeptionell, strategisch und auf lange Zeitdimensionen hin angelegt. Man habe Angst vor einer strategischen Herabstufung Frankreichs und Europas und sehe sich als „Macht des Gleichgewichts“, weshalb man auch darauf bedacht sei, Verbündeter, aber kein Vasall der USA zu sein.
Der Nachmittag stand im Zeichen des Gastlandes bzw. der deutsch-italienischen Beziehungen. Vor dem hochinteressanten Besuch der Villa Vigoni, dem deutsch-italienischen Zentrum für den europäischen Dialog, bei dem Magdalena Rabas eine hervorragende (kunst)historische Führung anbot, setzte Dr. Matteo Scotto einen Schwerpunkt auf die Politik Italiens unter Giorgia Meloni und die Auswirkungen der Regierungskonstellation auf das Europäische Parlament. Großes Interesse rief dabei das geglückte Vorhaben hervor, ein neues Wahlsystem zu implementieren. Durch diese Reform 2022 reduzierten sich die Sitze im Parlament erheblich. Die folgende Analyse des Ergebnisses der Parlamentswahlen führten zu ersten Bewertungen der Regierungsarbeit. Besonders augenfällig sei die Änderung der Einstellung zur EU hin zu pro. Außerdem gebe es starke Beziehungen zu den USA und klare Positionierungen gegen Russland, gegen China und für Taiwan.
Perspektivisch die größten Herausforderungen bestünden durch die komplizierten Beziehungen innerhalb der Regierungskoalition aus drei Parteien, die zudem auch noch drei verschiedenen Fraktionen im europäischen Parlament angehörten. Grundsätzlich könne man aber von einer stabilen Regierung sprechen. Das Verhältnis zu Deutschland sei zuletzt politisch durch die Asymmetrie der Regierungen (Mitte-links vs. Mitte-rechts) einerseits nicht einfach gewesen, andererseits seien beide Länder gegenseitig wichtige Wirtschaftspartner geblieben. Auch hier verspreche man sich von der neuen deutschen Regierung eine Verbesserung der Beziehungen.
Als nächstes widmete sich Dr. Heumann dem Stand der europäischen Sicherheitswende nach drei Jahren Krieg Russlands gegen die Ukraine und dem Befund, dass Trumps Priorität nicht hier, sondern bei China und im Indopazifik liege. Für die Ukraine gebe es zwei Verhandlungsgegenstände für gerechten und dauerhaften Frieden: Sicherheit und territoriale Integrität. Hierzu bedürfe es Garantien des Westens, aber wie könnten diese aussehen?
Die deutsche Haltung, Russland einzubinden, habe Tradition seit Bismarck (Appeasement) – zumal aus ökonomischem Interesse. Russland hingegen wolle eine Großmacht sein, sein Revisionismus und Imperialismus sähen Demokratien als Bedrohung. Vor Ort herrschten Mafiastrukturen. Die neue Ideologie laute: Konflikt mit dem Westen.
Die Stärke der NATO im Sinne von wirkungsvoller Abschreckung bestehe aus militärischer Überlegenheit und Glaubwürdigkeit. Letztere werde von russischer Seite in Zweifel gezogen. Die aktuelle Aufgabe bestehe darin, eine europäische Abschreckung zu erreichen, wenn der amerikanische Anteil der Unterstützung kompensiert werden müsse.
In diesem Zusammenhang bedürfe es der Führung durch Frankreich und Deutschland, um die Handlungsfähigkeit Europas zu gewährleisten, insbesondere in der Wirtschafts- und Sicherheitspolitik. Europa habe sich aber stets lernfähig gezeigt und entwickle kreativ neue Formate.
Am Nachmittag stand eine Exkursion nach Como, der „Hauptstadt der italienischen Seide“, auf dem Programm. Paolo Ortelli führte sowohl kundig als auch unterhaltsam und vermittelte den Teilnehmern wissenswerte Hintergründe zu Stadt und Region.
Der letzte inhaltliche Punkt betraf die transatlantischen Beziehungen unter Präsident Trump. Europa lerne, dass diese am Ende seien, zumindest in der bekannten Weise. Die USA strebten zum Unilateralismus (mehr als Isolationismus), also dem Ende der liberalen Ordnung, des Freihandels und der Globalisierung. An Bündnisse würden neue Maßstäbe gesetzt und sie als Kosten-Nutzen-Rechnung verstanden. Statt Diplomatie gelte Transaktionalismus und Geschäftemacherei. Vor allem mit Blick auf China mutierten Wirtschaftsfragen zu Machtfragen. So habe es im Bereich Zukunftstechnologien auf beiden Seiten neue „Sputnik-Momente“ gegeben: 2016 für China (Apple-Computer gewinnt ein GO-Spiel), 2025 für die USA (Deepseek schlägt ChatGPT).
Europas Interesse bestünde hingegen in der eigenen Souveränität im Multilateralismus. Hierzu versuche man sich mittels globaler Partnerschaften von diversen Abhängigkeiten zu befreien.
Dr. habil. Charrier betonte in seinem Fazit, es gebe trotz allem Grund für Optimismus: „Die Geschichte ist noch nicht geschrieben.“