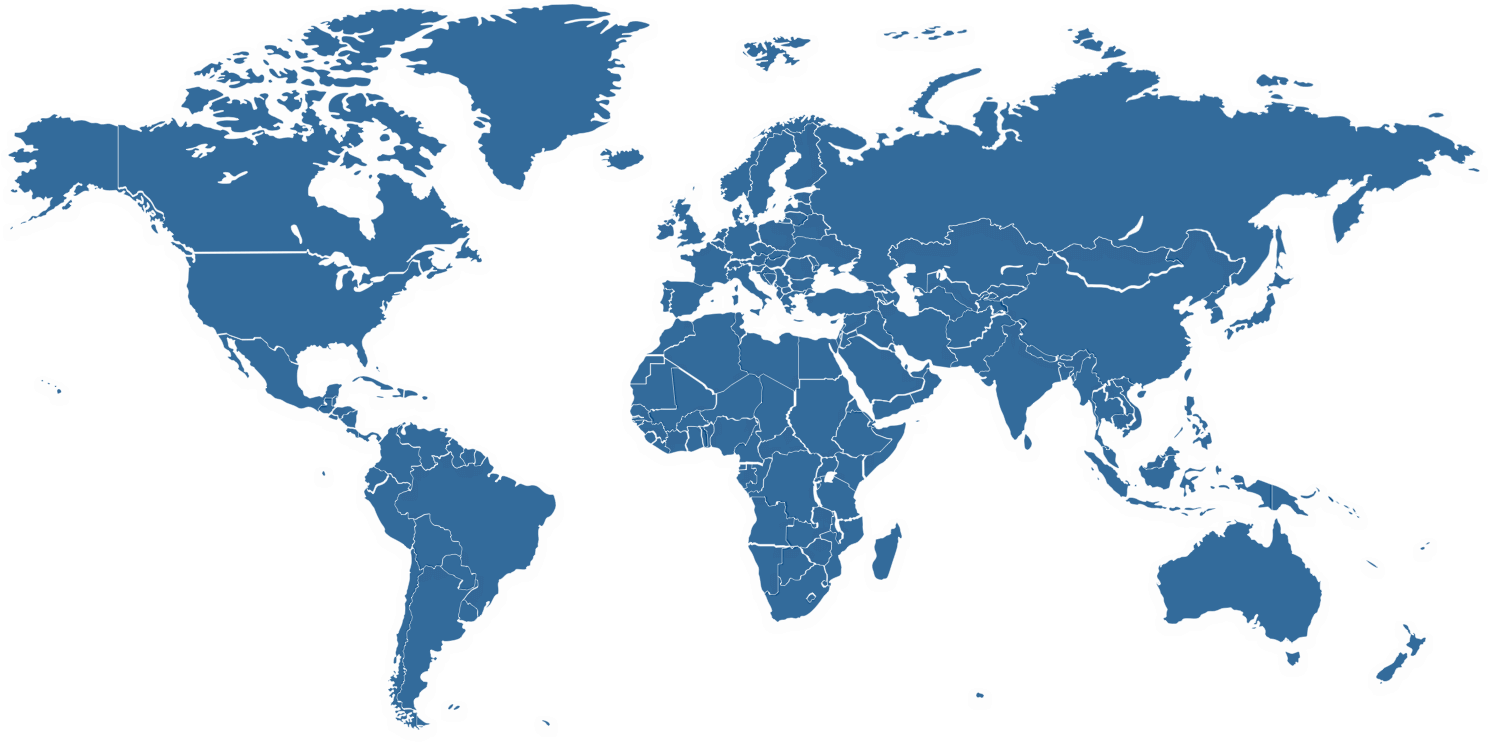Wie aber blicken die Staaten im Nahen Osten und Nordafrika auf diesen Krieg? Wie reagieren die Regierungen? Wie ist die öffentliche Haltung zum Krieg und welche Titel dominieren die Medien und Social Media? Wie werden Deutschland und Europa in diesem Kontext wahrgenommen?
Israel
von Dr. Michael Rimmel
Am frühen Morgen des 13. Juni 2025 begann Israel eine großangelegte militärische Operation. Innerhalb kürzester Zeit gelang es der israelischen Armee, nahezu die gesamte oberste militärische Führung der iranischen Revolutionsgarden auszuschalten sowie mehrere führende Atomwissenschaftler zu eliminieren. Gleichzeitig wurden durch bereits im Iran stationierte Agenten mehrere Luftabwehrstellungen neutralisiert. Dadurch konnte Israel die Lufthoheit gewinnen und gezielte Schläge gegen Atomanlagen sowie Waffendepots führen. Diese Operation wurde seit Jahren vorbereitet und befand sich in den letzten Monaten in konkreter Planung.
Sie fand in einem für Israel einmaligen strategischen Zeitfenster statt: Denn nach den Terrorangriffen vom 7. Oktober 2023 war es Israel gelungen, die vom Iran finanzierten Terrorgruppen in der Region markant zu schwächen – die Hamas im Gazastreifen, Hisbollah im Libanon, die Huthi im Jemen sowie verschiedene schiitische Milizen in Syrien und im Irak.
Erst mehr als 24 Stunden nach dem israelischen Präventivschlag gelang es dem Iran, mit ballistischen Raketen und Drohnen zurückzuschlagen. Bis zum 18. Juni 2025 hat der Iran über 400 Raketen und knapp 1000 Drohnen auf Israel abgefeuert. Obwohl ein Großteil durch das israelische Raketenabwehrsystem abgefangen werden konnte, verursachten einige Einschläge erhebliche Schäden in israelischen Städten. Dabei kamen 24 Zivilisten ums Leben, mehrere Hunderte wurden verletzt.
Laut der israelischen Regierung verfolgt die Operation gegen den Iran drei strategische Ziele: 1) Die Vernichtung des iranischen Atomprogramms, 2) die Zerstörung der iranischen ballistischen Fähigkeiten, und 3) die Eliminierung der sogenannten „Achse des Widerstands“.
Da eine vollständige Zerstörung der iranischen Atomanlagen ohne US-amerikanische Unterstützung kaum möglich ist, setzte Israel von Beginn an auf eine stärkere Einbindung der USA. In Jerusalem hofft man, dass dies – im Idealfall – zu einem Regimewechsel im Iran führen könnte. Da ein solches Szenario derzeit nicht realistisch erscheint, erhöhte Israel den politischen Druck auf US-Präsident Trump und seine Administration, militärisch einzugreifen. Dies ist am 22. Juni 2025 geschehen, als das US-amerikanische Militär drei zentrale Atomanlagen (Fordow, Natanz und Isfahan) im Iran mit bunkerbrechenden Waffen direkt angegriffen und zu ihrer weitgehenden Zerstörung beigetragen hat.
Politisch wie auch gesellschaftlich herrscht zum aktuellen Zeitpunkt ein breiter Konsens - auch innerhalb der meisten Oppositionsparteien - über die Notwendigkeit, der iranischen Bedrohung mit aller Konsequenz entgegenzutreten. Eine Hauptfrage der nächsten Tage und Wochen wird daher sein, wie der Krieg nach diesen strategischen Erfolgen beendet werden kann, ohne dass es zu einer größeren regionalen Eskalation kommt.
Iran
von Philipp Dienstbier
Die Regierung der Islamischen Republik Iran prangert die israelischen Militärschläge sowie die US-Schläge auf Atomanlagen als Bruch des Völkerrechts sowie als Kriegsverbrechen an. Sie sieht sich daher im Recht, mit militärischen Gegenangriffen zu reagieren – auf Israel und, nun als Vergeltung für die Bombardierung von Nuklearanlagen durch die Vereinigten Staaten, auch gegen US-Interessen. Amerikanische Kapitulationsforderungen lehnt der Oberste Führer Irans Ali Chamenei kategorisch ab. Stattdessen hat Teheran eine Einstellung aller Militärangriffe auf sein Territorium als Vorbedingung für eine Aufnahme von Friedensgesprächen erklärt. Damit hält Iran die Tür für diplomatische Verhandlungen weiterhin offen – wobei bislang unsicher scheint, dass die Islamische Republik bei Gespräch auch zu neuen Zugeständnissen bereit wäre.
Das „reformistische“ Lager Irans verurteilt zwar ebenso die israelischen Angriffe, hält sich aber mit Forderungen nach Vergeltung gegen Israel eher zurück, obwohl es eine Verteidigung gegen Angreifer als ebenso legitim bezeichnet. Konservative und Hardliner im Parlament und in den Medien fordern eine harte „Rache“ an Israel, den sofortigen Austritt aus dem Nichtverbreitungsvertrag (NVV) bis hin zum Bau einer Atombombe sowie seit den US-Angriffe auf Nuklearanlagen verstärkt auch die Schließung der Straße von Hormus. Wenige konservative Stimmen mahnen jedoch auch, eine atomare Bewaffnung würde globale Unterstützung verspielen, und verweisen auf das Verbot einer Atombombe durch einen Erlass Chameneis.
Die Bevölkerung Irans ist hinsichtlich der Angriffe gespalten. Öffentliche Debatten stehen im Zeichen des Krieges, der viele Iraner – gerade aus Teheran – zu einer Flucht im eigenen Land gezwungen hat. Die Machtbasis des Regimes demonstrierte wiederholt öffentlichkeitswirksam gegen die israelischen Angriffe und fordert ebenso eine nukleare Bewaffnung sowie harte Gegenschläge gegen Israel. Dennoch lehnt grundsätzlich eine Mehrheit in Iran das Regime ab und gibt ihm zumindest eine Mitschuld für den aktuellen Krieg. Innerhalb dieses Lagers sieht ein eher kleiner Teil die gegenwärtigen Angriffe als Gelegenheit, sich der islamischen Führung zu entledigen, während beim größeren Teil die Sorge vor möglichem Chaos durch einen Regimewechsel überwiegt.
Das Stimmungsbild änderte sich im Kriegsverlauf bereits spürbar. Während in frühen Kriegstagen das Ausschalten hoher Revolutionsgarden noch als Entledigung zentraler Elemente eines verhassten Systems begrüßt wurde, wächst nun die Sorge, dass ideologisch weit radikalere Persönlichkeiten in Führungsstrukturen nachrücken könnten. Die Ausweitung der ursprünglich auf militärische Ziele begrenzten israelischen Angriffe und wachsende zivile Opferzahlen führen ebenso zu einem Stimmungswandel gegen Israel.
Deutschland und Europa werden vom iranischen Regime einerseits Doppelstandards vorgeworfen, da diese sich im iranischen Narrativ als Verteidiger des Völkerrechts stilisierten, jedoch zugleich israelische Angriffe nicht verurteilten, obwohl diese angeblich rechtswidrig seien. Gleichzeitig will das iranische Regime Europa aber als möglichen Unterstützer für ein Ende der Kampfhandlungen sowie für eine Wiederaufnahme von Verhandlungen gewinnen, welche die Islamische Republik als Atempause nutzen will, um seine Strukturen zu konsolidieren. Mit diesem Ziel führte der iranische Außenminister jüngst direkte Gespräche mit seinen europäischen Kollegen.
Golf-Staaten
von Philipp Dienstbier
Die Reaktion der Golf-Staaten ist geprägt von Sorge über eine Eskalation des Krieges zwischen Iran und Israel. Beim möglichen Ausgreifen der Kampfhandlungen wähnen sich die arabischen Monarchien hinsichtlich ihrer geografischen Nähe, Abhängigkeit von Schiffsrouten durch den Persischen Golf und die Straße von Hormus sowie bei möglichen Vergeltungsschlägen gegen US-Militärbasen in Bahrain, Katar und Kuwait in der Schusslinie.
Vor diesem Hintergrund hat die Führungsmacht Saudi-Arabien die jüngsten israelischen Angriffe auf Iran offiziell verurteilt und dabei Iran sogar als „brüderliche“ Islamische Republik bezeichnet. Dies ist eine bemerkenswerte Formulierung, die auch Katar in seiner offiziellen Erklärung verwendete. Ebenso haben sich die übrigen Staaten des Golf-Kooperationsrates (GCC) einstimmig gegen den israelischen Angriff ausgesprochen, der als eine Verletzung des internationalen Rechts und der territorialen Integrität Irans deklariert wird. Eine entsprechende Erklärung haben sämtliche Golf-Staaten gemeinsam mit 15 weiteren arabischen und muslimischen Staaten unterzeichnet.
Auch über die US-Schläge gegen das iranische Atomprogramm ist man besorgt, in offiziellen Erklärungen schlagen die Golf-Staaten jedoch zurückhaltendere Töne gegenüber ihrem wichtigsten Verbündeten an. Gleichzeitig führen die GCC-Monarchien einen engen Dialog mit allen Seiten, einschließlich Iran, um auf ein Ende der Kampfhandlungen und die Rückkehr zu Verhandlungen hinzuwirken. Während Oman, das als Mediator amerikanisch-iranischer Atomgespräche fungierte, den Abbruch selbiger scharf kritisierte, versucht nun auch Katar, sich als Mittler bei Verhandlungen mit Iran in Stellung zu bringen.
In der Berichterstattung sowie in öffentlichen Debatten in den Golf-Staaten sind neben Beiträgen, die Israel verurteilen, auch Stimmen zu vernehmen, die anmahnen, dass Iran ethnische Konflikte in der direkten Nachbarschaft, wie dem Jemen, anheizt und die Golf-Staaten seit der islamischen Revolution 1979 mit dem Revolutionsexport bedroht. In der öffentlichen Debatte überwiegt somit eine sogenannte „positive Neutralität“ gegenüber den Kriegsparteien, die Äquidistanz wahrt, wenngleich gegenwärtig in dem israelischen Angriff die akut größere Bedrohung für regionale Stabilität gesehen wird.
Von Kuwait bis Oman bewegt die Bevölkerung zudem die Wahrnehmung, dass Israel wiederholt seine Nachbarn ungehindert angreifen konnte, ohne dass die USA oder andere Akteure Israels Regierung dabei Restriktionen auferlegten. In diesem Kontext werden gerade in katarischen Medien immer wieder Parallelen zwischen dem israelischen Krieg gegen Iran und dem im Gaza-Streifen gezogen.
Die öffentliche Debatte und politische Rhetorik dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass hinter verschlossenen Türen am Golf auch anerkannt wird, dass das iranische Nuklearprogramm ebenfalls für die GCC-Staaten eine existenzielle Bedrohung darstellt – und dessen Zerstörung daher auch Gutes hat. Jedoch birgt die nun von Israel und den USA verfolgte militärische Lösung der Nuklearfrage aus Sicht der Golf-Staaten ein zu hohes Eskalationsrisiko, nicht zuletzt für den Golf selbst. Gerade nach den US-Angriffen bewegt den Golf die Sorge, dass sich dortige amerikanische Basen, etwa in Bahrain, nun im Fadenkreuz iranischer Vergeltungsschläge befinden. Weiterhin präferieren die Machthaber am Golf einstimmig eine diplomatische Lösung mit Iran.
Deutschland wird mit Blick auf eine Lösung des Konflikts am Golf wenig Gestaltungsmacht zugestanden. In den Atomverhandlungen haben die USA nach Lesart der Golf-Staaten längst die E3 hinter sich gelassen. Als einzig ausschlaggebenden Akteur vis-à-vis Iran sieht man daher nur noch die Vereinigten Staaten. Allenfalls äußern die Golf-Staaten die Forderung, dass Deutschland mit seinen guten Beziehungen zu Israel dort eine Eingrenzung der Angriffe erwirken möge. Auf Europas Beziehungen zu Teheran, die der Golf einst als Gesprächskanal nutzte, ist man in den GCC-Staaten hingegen längst nicht mehr angewiesen – pflegt man inzwischen doch selbst einen engen diplomatischen Austausch mit Iran.
Jordanien
von Dr. Edmund Ratka
Jordanien ist aufgrund seiner geographischen Lage besonders von der israelisch-iranischen Auseinandersetzung betroffen. Während Israel bei seinen Luftangriffen auf den Iran in der Regel jordanischen Luftraum nicht verletzt, erstreckt sich die Flugbahn iranischer Raketen auf Israel – und israelischer Luftverteidigung – vorwiegend über Jordanien und seine Bevölkerungszentren im Norden, inklusive der Hauptstadt Amman. Die daraus folgende massive Einschränkung des zivilen Luftverkehrs führt zu wirtschaftlichen Beeinträchtigungen, insbesondere im Tourismus. Durch herabfallende Raketen- und Drohnentrümmer wurden bereits mehrere Personen verletzt.
Generell ist Jordanien an einer Stabilisierung der regionalen Situation interessiert und möchte den internationalen Fokus auf der für das Land wesentlich existenzielleren Frage halten, nämlich den Krieg im Gaza-Streifen und eine Bearbeitung des israelisch-palästinensischen Konflikts. Obwohl der Iran in Jordanien traditionell wenig Sympathien genießt und für seine aggressive Regionalpolitik immer wieder in der Kritik steht, wird sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung die Verantwortung für die jetzige Eskalation Tel Aviv zugeschrieben – eben auch vor dem Hintergrund des in Jordanien stark kritisierten israelischen Vorgehens seit dem 7. Oktober 2023 in den Palästinensischen Gebieten und einer vermuteten „expansionistischen“ Agenda Israels in der Region.
Die jordanische Regierung hat den israelischen Angriff vom 13. Juni 2025 umgehend scharf verurteilt, sich aber am Folgetag beim Abschuss der ersten iranischen Welle an Drohnen auf Israel an deren Abschuss beteiligt. Begründet wurde dies mit der Verteidigung des eigenen Luftraums. Dass Jordanien nicht zum „Schlachtfeld für irgendeinen Konflikt“ werden dürfe, ist die zentrale Botschaft, die auch König Abdullah II. immer wieder vermittelt, und die auf positive Resonanz in der Öffentlichkeit stößt. Jordaniens Diplomatie engagiert sich intensiv für eine Deeskalation und möchte ein weiteres Ausgreifen des Konflikts mit einer Beteiligung der USA unbedingt vermeiden. Befürchtet wird in Amman, dass dies dann auch die innenpolitischen Spannungen weiter verstärken könnte, etwa zwischen den eher pro-palästinensisch orientierten und den jordanisch-nationalistischen Gruppen.
Das Königreich beheimatet mit Al-Azraq zudem einen der wichtigsten amerikanischen Militärstützpunkte im Nahen Osten. In Folge des US-Angriffs auf die Nuklearanlagen am 22. Juni warnte die Regierung vor „schwerwiegenden Konsequenzen“ und forderte die Einhaltung des Völkerrechts sowie die Rückkehr zu „Diplomatie und Dialog“ – ohne aber die USA namentlich zu erwähnen.
Die deutsche und europäische Verurteilung des Iran wird von weiten Teilen der Öffentlichkeit als einseitig empfunden und in den Vorwurf von der „Doppelmoral des Westens“ eingeordnet, der seit dem Gaza-Krieg in Jordanien Hochkonjunktur hat. In diesem Sinne fand auch die öffentliche Befürwortung des israelischen Angriffs auf die iranischen Nuklearanlagen durch Bundeskanzler Friedrich Merz bzw. seine Aussage von der „Drecksarbeit“ auf jordanischen Online-Nachrichten-Seiten und in den Sozialen Medien breite und sehr kritische Resonanz.
Ägypten
von Steffen Krüger
Nach der jüngsten Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran am 13. Juni reagierte das ägyptische Außenministerium besorgt und rief in einer offiziellen Erklärung beide Seiten zu „äußerster Zurückhaltung“ auf, um eine gefährliche Zuspitzung der Lage in der Region zu vermeiden. Präsident Sisi unterhielt sich mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi und betonte dabei, dass ein ausgewachsener Krieg unbedingt verhindert werden müsse, da dieser eine Gefahr für die regionale Sicherheit und Stabilität darstelle. Ägypten hat ebenfalls seine diplomatische Vermittlung angeboten und steht in aktivem Kontakt mit allen betroffenen Parteien, um die Spannungen zu deeskalieren.
In den staatlichen und unabhängigen ägyptischen Medien wird ebenfalls vor einer Ausweitung des Konflikts gewarnt. In der ägyptischen Öffentlichkeit gilt das iranische Regime zwar als Erzfeind, in den Medien überwiegen jedoch die Solidarität mit dem palästinensischen Volk und die Verurteilung der israelischen Maßnahmen.
Zeitgleich unternahm der deutsche Außenminister Johann Wadephul seine erste offizielle Nahostreise und machte dabei am 12. und 13. Juni in Kairo Station. Bei einem Treffen mit seinem ägyptischen Amtskollegen Badr Abdelatty erörterte er die Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit sowie die Bewältigung drängender regionaler Probleme. Seine Reaktion auf die Angriffe in Israel und im Iran sowie seine Betonung des deutschen Engagements für Deeskalation, humanitäre Unterstützung und regionalen Dialog fanden in Ägypten große Aufmerksamkeit.
In erster Linie sind jedoch die Entscheidungen der USA in der Region für die ägyptische Regierung maßgebend. Denn so war es bspw. dem Eingreifen der USA in den Konflikt zwischen den Huthi-Rebellen und Israel zu verdanken, dass sich die Lage im Roten Meer wieder beruhigte und Ägypten wieder auf die vollständige Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs im Suezkanal hoffen konnte. Nun befürchtet man, dass im Kontext des israelisch-iranischen Krieges der Handel in der Region weiterhin gefährdet bleibt. Insbesondere mögliche Erhöhungen des Ölpreises bereiten der ägyptischen Regierung, die den Benzinpreis stark subventioniert, große Sorgen.
Die Luftangriffe auf die iranischen Atomanlagen durch die US-Streitkräfte wurden bisher weder verurteilt noch positiv bewertet. Trotz der langen Feindschaft mit Iran, hält sich die Regierung in Kairo sehr bedeckt und nimmt eine Rolle als Vermittler ein.
Libanon
von Michael Bauer
Die libanesische Regierung bemüht sich um Neutralität und warnt vor einer Eskalation auf libanesischem Boden. Präsident Aoun und Premierminister Salam verurteilten den israelischen Angriff auf den Iran als völkerrechtswidrig und betonten gleichzeitig, dass die Entscheidung über Krieg oder Frieden ausschließlich beim Staat liege. Diese Haltung wurde auch nach dem US-Angriff auf den Iran in der Nacht des 21. Juni nochmals betont. Ein deutliches Signal and Hisbollah, dass man ein Eingreifen der Organisation in den Krieg nicht dulden werde. Parlamentspräsident Berri erklärte, der Libanon werde sich „zu 200 %“ nicht am Krieg beteiligen – aus nationalem Interesse und weil der Iran keine Unterstützung benötige.
Die Hisbollah positioniert sich klar an der Seite des Iran im aktuellen Krieg mit Israel und der USA. Generalsekretär Naim Qassem erklärte, Neutralität sei angesichts der „Aggressionen der USA, Israels und der Mächte der Arroganz“ unmöglich. Die Unterstützung für den Iran sei selbstverständlich, über deren Art und Zeitpunkt entscheide man jedoch eigenständig. Eine ähnliche Wortwahl wurde in einem Kommuniqué nach den US-Angriffen auf den Iran genutzt. Damit hält sich die Hisbollah bewusst vage.
In den libanesischen Medien und sozialen Netzwerken überwiegt die Angst vor einer regionalen Ausweitung des Krieges. Hashtags wie #NoWarOnLebanon oder #LebanonNeutrality werden vielfach geteilt. Medien berichten detailliert über die ohnehin anhaltenden israelischen Drohnenangriffe im Süden des Landes und warnen vor den Folgen einer Hineinziehung des Landes in den Krieg. Gleichzeitig gibt es pro-iranische Solidaritätsbekundungen und polarisierende Narrative, insbesondere aus dem Hisbollah-nahen Medienspektrum.
Europa und Deutschland werden im libanesischen Diskurs widersprüchlich wahrgenommen. Einerseits gibt es die europäischen und deutschen Aufrufe zur Deeskalation, andererseits wird in den libanesischen Medien über die deutliche Positionierung Deutschlands und der großen EU-Staaten auf Seiten Israels berichtet. Insgesamt fehlt es aus Sicht vieler Kommentatoren an einer sichtbaren, einheitlichen europäischen Außenpolitik. Die EU erscheint diplomatisch bemüht, aber geopolitisch wirkungsschwach. Der Umstand, dass der US-Angriff ohne vorherige Information an die Europäer stattfand, bestärkt diese Wahrnehmung.
Türkei
von Dr. Ellinor Zeino
Die türkische Regierung hat sich klar gegen die israelischen Angriffe auf den Iran positioniert. Die Angriffe verstößen gegen das Völkerrecht. Verhandlungen seien der einzige Weg zur Konfliktbeilegung. Israel sei unter seiner aktuellen Führung die größte Bedrohung für Frieden und regionale Stabilität und betreibe eine strategische Destabilisierungspolitik. Präsident Erdoğan betonte zudem, dass trotz der jüngsten Entwicklungen der Krieg in Gaza nicht in den Hintergrund rücken dürfe. Am 16. Juni bot Präsident Erdoğan an, die Türkei könne als Gesprächsvermittler dienen – sowohl für ein Kriegsende als auch zur Wiederaufnahme der Atomverhandlungen. Das türkische Parlament nahm am 17. Juni einstimmig einen Antrag an, der Israels Handlungen im Gazastreifen als „Völkermord“ sowie die Angriffe in Iran als „völkerrechtswidrige Destabilisierungsstrategie“ auf das Schärfste verurteilt und die internationale Staatenwelt auffordert, Verantwortung auf Grundlage von Diplomatie und Völkerrecht zu übernehmen.
In der türkischen öffentlichen Debatte herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass die israelische Regierung eine Bedrohung sowohl für die Türkei als auch für die regionale und globale Sicherheit darstelle sowie die Sorge, dass die Angriffe sich in einen regionalen oder gar weltweiten Flächenbrand ausweiten könnten. Ein großer Krieg in der Nachbarschaft könne die Türkei strategisch wie auch wirtschaftlich treffen, sei es durch steigende Energiepreise, mögliche Flüchtlingsströme aus dem Iran und durch neue Sicherheitsrisiken (Radikalisierung, Terrorismus) in der Region. Die Beteiligung der USA an den Angriffen wird mit großer Sorge vor einer weiteren Eskalation betrachtet. Die Türkei warnt vor unabsehbaren Konsequenzen ohne dabei die USA direkt zu verurteilen oder sich gegen ihren amerikanischen Verbündeten zu stellen.
In den türkischen Medien wird die Haltung und Positionierung Deutschlands und der Europäischen Union gegenüber Israel eher kritisch gesehen. Offizielle Stimmen kritisieren eine „Doppelmoral“ und bzw. die Zurückhaltung und das „moralische Schweigen“ Europas. Laut Präsident Erdoğan trügen auch jene Akteure, die Israels „Übermut unterstützen oder schweigend zusehen“, ebenso Mitschuld an der Krise. Die aktuellen Aussagen von Bundeskanzler Merz wurden von regierungsnahen Medien als offizielle Rückendeckung Berlins für Israels Vorgehen gewertet. In einem Telefonat mit Bundeskanzler Merz warnte Erdoğan vor Konsequenzen auch für Europa wie zum Beispiel Migration und einer nuklearen Katastrophe.
Irak
von Dr. Edmund Ratka
Die irakische Regierung hat den israelischen Angriff auf den Iran verurteilt und spricht sich für Deeskalation und das Ende militärischer Gewalt aus. In der Öffentlichkeit bzw. in den Sozialen Medien dominiert die Wahrnehmung Israels als Aggressor. Besonders harsch fiel die Verurteilung Tel Avivs seitens der schiitischen Kräfte, etwa durch Groß-Ayatollah Ali Al-Sistani, aus. Grundsätzlich bemüht sich der Irak jedoch, nicht in die Konfliktspirale zwischen Israel und dem Iran hineingezogen zu werden. Zwar protestiert Bagdad gegen die Verletzung seines Luftraums durch Israel bei dessen Angriffen auf den Iran, betont dabei aber seine eigene Souveränität. Selbst die Iran-nahen Milizen im Land sind bislang nicht willens und/oder in der Lage selbst militärisch einzugreifen. Einige Iran-nahe Gruppierungen, allen voran die Miliz Kataib Hisbollah, hatten angekündigt, bei einem Kriegseintritt der USA auch amerikanische Ziele im Irak und der Region zu attackieren. Dies ist aber nach dem US-Angriff auf die iranischen Nuklearanlagen vom 22. Juni bislang nicht passiert. Die Regierung erklärte, die Eskalation gefährde Frieden und Sicherheit in der Region und verstoße gegen das Völkerrecht, vermied dabei aber eine explizite Erwähnung der USA.
Das Bemühen um Nicht-Einmischung in den gegenwärtigen Konflikt spiegelt die Kriegsmüdigkeit und den Pragmatismus wider, der sich in den letzten Jahren im Irak ausgebreitet hat. Es reflektiert außerdem die Priorität des Irak, der Beziehungen gleichermaßen mit Teheran und Washington pflegt, die Kohärenz des eigenen Landes nicht zu gefährden. Man will auf keinen Fall wieder Austragungsort geopolitischer Rivalitäten werden, die dann innere Spaltungen verstärken. Eine weitere Eskalation des Konflikts würde den Balanceakt in Bagdad jedoch zunehmend schwieriger machen.
Die deutsche und europäische Position wird vor allem in traditionell dem Iran nahestehenden, vorwiegend schiitischen Kreisen sehr negativ rezipiert und als Unterstützung israelisch-westlicher Pläne zur Dominanz der Region interpretiert. Dies spielt in der gesamt-irakischen Diskussion aber eher eine untergeordnete Rolle, wo man sich vor allem um die Stabilität und Entwicklung des eigenen Landes sorgt.
Tunesien
von Winfried Weck
Das tunesische Außenministerium veröffentlichte, nach den israelischen Angriffen auf den Iran, am Abend des 13. Juni ein Statement auf seinen sozialen Medienseiten, das die „heimtückische zionistische Aggression gegen die Islamische Republik Iran“ aufs Schärfste verurteilte und die brüderliche Verbundenheit mit dem iranischen Volk hervorhob. Es sei jedoch notiert, dass das von Ägypten initiierte gemeinsame Statement von 21 arabischen und muslimischen Staaten, das am 16. Juni veröffentlicht wurde, Israels Angriff auf den Iran verurteilte und eine sofortige Waffenruhe fordert, von der tunesischen Regierung nicht unterzeichnet wurde.
In den Rundfunkmedien wurde und wird über den Krieg berichtet. Jedoch stand zunächst auch das Schicksal des von privaten Initiativen organisierten Hilfskonvois für den Gazastreifen im Interesse der Öffentlichkeit, der im Osten Libyens gestoppt wurde.
In den sozialen Medien wird der israelisch-iranische Konflikt mit unverminderter Heftigkeit diskutiert. Die Sympathien der tunesischen Öffentlichkeit liegen dabei eindeutig auf Seiten des Irans.
Den amerikanischen Angriff vom 22. Juni auf die Atomanlagen im Iran hat das tunesische Außenministerium scharf verurteilt und den "sofortigen Stopp dieser Aggression" gefordert. Es forderte auch die Reform des internationalen Systems, das noch immer die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs widerspiegele. In der Öffentlichkeit wird der Iran tendenziell als Widerstandskraft gegen die Hegemonie der USA und den Zionismus im Nahen Osten wahrgenommen. Die öffentliche Meinung sympathisiert fast vollständig mit dem Iran und lehnt den US-Militärangriff ab.
Marokko
von Steven Höfner
Die marokkanische Regierung hat sich mit Äußerungen zum Iran-Israel-Krieg bislang zurückgehalten. Auch der Einsatz der US-Streitkräfte gegen iranische Atomanlagen wurde nicht kommentiert. Offizielle Stellungnahmen aus Rabat beschränken sich auf Appelle zur Deeskalation. Eine direkte Positionierung oder Unterstützung einer der Seiten liegt nicht vor. Berichte über mögliche logistische Unterstützung für Israel wurden von der Regierung weder bestätigt noch kommentiert. Marokko sieht den Iran als systemischen Gegenspieler in der Region. So führt u.a. die iranische Unterstützung für die Polisario in der Westsahara zu einem Interesse Marokkos an einer Schwächung des iranischen Regimes. Gleichzeitig muss die marokkanische Führung Rücksicht auf eine pro-palästinensische Grundstimmung in Marokko nehmen, die das Vorgehen Israels in der Region insgesamt kritisch sieht. Die Beziehungen Marokkos zu Israel stellen daher seit dem 7. Oktober 2023 einen Balanceakt dar zwischen den Interessen des Staates und der pro-palästinensischen Grundüberzeugung der breiten Bevölkerung.
Israel-kritische Äußerungen sind zuvorderst in den Reihen der oppositionellen Partei PJD, die sich als islamisch-konservative Strömung mit dem Iran solidarisierte, zu finden. Diese Äußerungen finden in ihrer Israelkritik einen Widerhall in den Sozialen Medien, wobei die Solidarität eindeutig den Palästinensern gilt und nicht dem Iran. Pro-iranische Statements sind kaum vorhanden.
Marokkos Nachrichtenlandschaft benennt dagegen vor allem die humanitären Auswirkungen des Konflikts und warnt vor Eskalationsgefahren. Die Debatten in den Medien drehen sich zudem um die regionalen Rollen insbesondere der USA und der Golfstaaten. Der Einsatz der US-Streitkräfte wurde hauptsächlich deskriptiv dargestellt. Dabei überwog die Sorge vor einer regionalen Gewaltspirale, es kam aber nicht zu einer Verurteilung der US-Aktionen.
Deutschland wird als Teil des europäischen Blocks wahrgenommen, der Abstand zur militärischen Eskalation hält, aber auch keine aktive Führung in der Konfliktlösung einnehmen kann.
Mauretanien
von Steven Höfner
Die mauretanische Regierung reagierte unmittelbar nach dem Beginn der militärischen Konfrontation zwischen Israel und dem Iran. Sie verurteilte dabei die israelischen Luftangriffe, die als „Verstoß gegen die iranische Souveränität und die UN-Charta“ bezeichnet wurden. Mauretanien beteiligte sich an der gemeinsamen Erklärung von 21 islamischen Staaten, in der ein sofortiger Stopp aller militärischen Aktionen gefordert wurde. Die mauretanische Regierung betonte in ihren Äußerungen die Einhaltung von internationalem Recht und kritisierte damit Israel für seinen Angriff. Diese Position wiederholte sie nachdrücklich nach dem US-Angriff auf iranische Atomanlagen.
In der öffentlichen Stimmung zeigen sich eine breite Solidarität für Iran, jedoch häufig auch in Verbindung mit dem Krieg im Gaza-Streifen. Dabei wird der Iran oftmals als „widerständige Kraft“ beschrieben, die auch gegen das Leid im Gaza-Streifen aufbegehre. In Nouakchott kam es in den ersten Tagen der Eskalation vor der US-Botschaft zu Protesten einiger hundert Demonstranten in Solidarität mit Iran und dem Gaza-Streifen. Auch nach dem Eingreifen der USA kam es zu vereinzelten Protestaktionen vor der US-Botschaft.
Die mauretanischen Medien berichten überwiegend mit Schlagzeilen wie „Solidarität mit Iran-Gaza“ oder „Verurteilung der israelischen Aggression“. In sozialen Netzwerken kursieren Hashtags wie „#SolidarityIran“ und „#FreePalestine“, vielfach gestützt durch Zitate religiöser Führer und Aktivisten. So betonten einige dieser religiösen und politischen Aktivisten in lokalen Radiosendungen und Predigten, dass die mauretanische Solidarität „nicht nur symbolisch“ sei, sondern auch praktische Formen wie Spendenaktionen und Informationskampagnen umfasse. Es zeichnet sich somit eine klare öffentliche Meinungslinie gegen Israel und die USA ab, zugunsten des Iran bzw. dem Gaza-Streifen.
In den mauretanischen Debatten werden Deutschland und Europa eher implizit wahrgenommen als Teil der westlichen Welt. Dabei wird die Unterstützung Europas und der USA für Israel deutlich negativ konnotiert, womit Mauretanien ein verstärkt Israel- und US-kritisches Profil entwickelt.