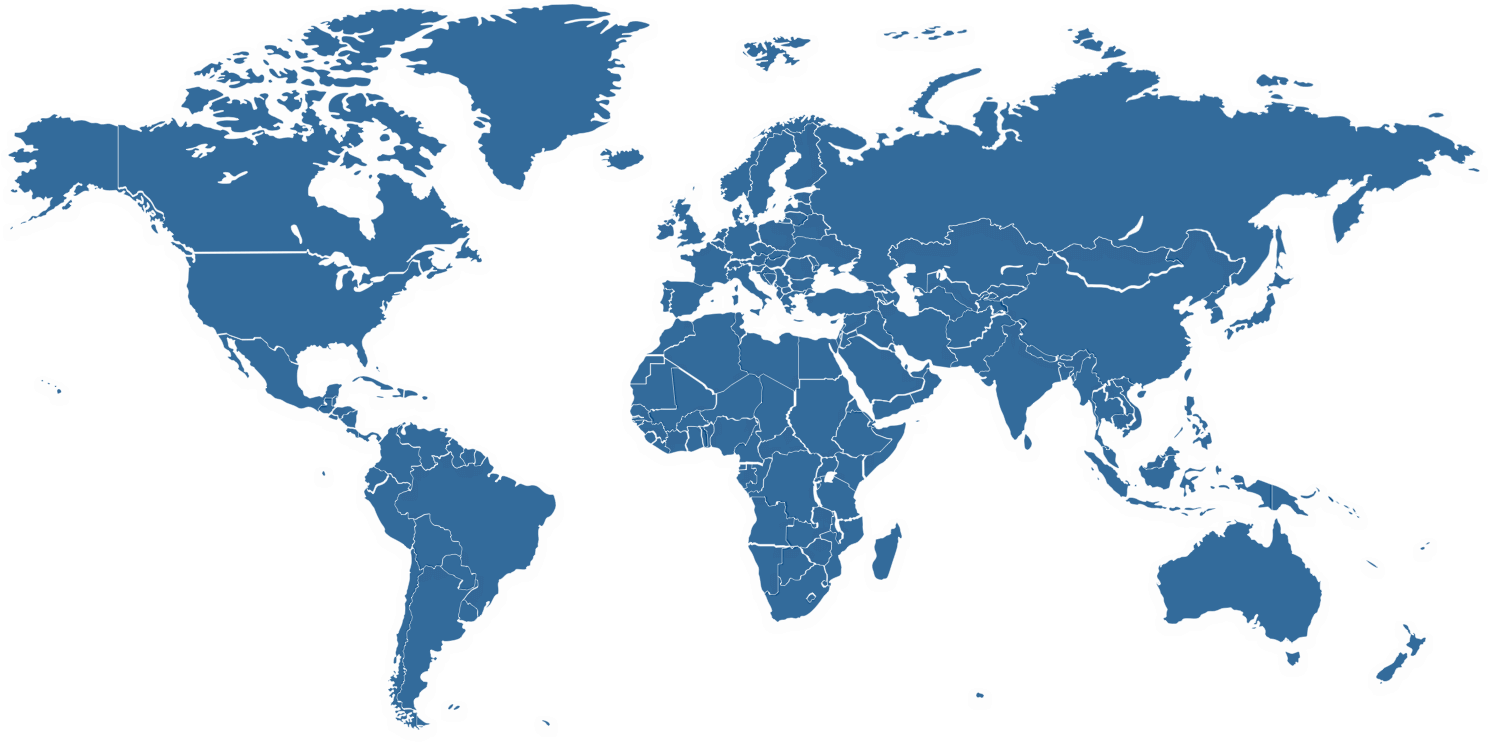Über diese Reihe
Die Konrad-Adenauer-Stiftung, ihre Bildungsforen und Auslandsbüros bieten jährlich mehrere tausend Veranstaltungen zu wechselnden Themen an. Über ausgewählte Konferenzen, Events, Symposien etc. berichten wir aktuell und exklusiv für Sie unter www.kas.de. Hier finden Sie neben einer inhaltlichen Zusammenfassung auch Zusatzmaterialien wie Bilder, Redemanuskripte, Videos oder Audiomitschnitte.