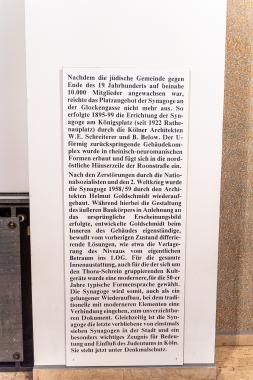Eigentlich war dieser JugendpolitikTag zum großen Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ geplant, doch die Pandemie hat die Kooperation der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. mit der Synagogengemeinde Köln und der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit immer wieder aufgeschoben. Nun aber freuten sich alle, persönliche Gespräche und Begegnungen nutzen zu können, um in eine für manche unbekannte Religion und Kultur einzutauchen.
Frag den Rabbi!
Abraham Lehrer begrüßte seitens des Vorstands der Gemeinde die Jugendlichen und gab ihnen mit auf den Weg, sich für Demokratie, Gleichberechtigung und gegenseitige Anerkennung einzusetzen, um ein friedliches und respektvolles Zusammenleben zu ermöglichen. Diesem Anliegen stehen meist Vorurteile im Weg, ein Nicht-oder Halb-Wissen, das zu Missverständnissen oder gar Ablehnung führt. Hier hilft Aufklärung – und somit war der Einstieg „Frag den Rabbi“ eine wunderbare Gelegenheit für die Schülerinnen und Schüler, um Fragen loszuwerden, Regeln des Judentums mit der eigenen Religion zu vergleichen, aber auch aus der Geschichte Verständnis für heutige Haltungen und Interessen zu entwickeln.
„Wir müssen Zivilcourage an den Tag legen. Wir müssen mutig sein.“ (Rabbiner Brukner)
Vom jüdischen Leben ist noch immer nicht oder wieder nicht ohne Antisemitismus zu erzählen. Auch Rabbiner Brukner berichtete, dass er bei seiner Ankunft in Köln vor fünf Jahren gebeten wurde, nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, sondern Taxis zu nutzen. Er hält sich nicht (immer) daran – und so musste er von Vorkommnissen berichten, die die Irrationalität solcher Angriffe zeigen:
„We have to kill you all“, schallte es ihm einmal von einem Fahrgast in der Bahn entgegen, und seine Frau, die hilfsbereit einem älteren Herrn ihren Sitzplatz anbot, wurde von diesem angegiftet mit den Worten „Das wird an unserem Hass gegen Sie auch nichts ändern.“ Erschreckend sei es in diesem Moment, als Opfer allein zu stehen. Rabbiner Brukner rief die Jugendlichen zu Zivilcourage auf – sollte die direkte Ansprache des Täters zu gefährlich sein, so freue sich aber das Opfer über ein nettes Wort, Mitgefühl und Mut. Schweigen bedeute Zustimmung und stärke den Täter. Für das Opfer sei das Gefühl wichtig, nicht allein zu sein. Man müsse verstehen, dass man sich in dieser Gesellschaft nicht unsicher fühlen dürfe.
Die Schülerinnen und Schüler nutzten die Gelegenheit, um Fragen zu stellen:
Wird man jüdisch geboren oder kann man konvertieren? Die Antwort war eindeutig: Wenn die Mutter jüdisch ist, ist auch das Kind jüdisch. Konvertieren sei schwierig, aber es könne möglich gemacht werden. Das brachte natürlich Fragen zum quantitativen Umfang der Gemeinde mit sich. 4.000 Mitglieder zähle sie, darunter 80% Immigranten aus der ehemaligen Sowjetunion, die teilweise den Kontakt zur Religion verloren hätten, aber die jüdische Kultur doch als Teil ihres Lebens begriffen. An Schabbat kommen um die 100 Personen in die Synagoge, an den hohen Festtagen 300 bis 400.
Was heißt für Sie, Jude sein? – Die Beantwortung dieser sehr grundsätzlichen Frage hätte vermutlich den Rest des Tages einnehmen können, aber Rabbiner Brukner fasste prägnant zusammen: Jude sein sei etwas, das sein ganzes Leben ausfülle, jede Sekunde. Er sei immer im Gespräch mit Gott. Thora und Talmud geben die Regeln vor, aber auch die Verbundenheit mit den eigenen Wurzeln ist Teil des Jüdischseins. So schaffte es sein Vater mit 14 Jahren als einziges von fünf Kindern vor der Deportation zu fliehen, später in Buchenwald befreit und mit einem Kindertransport in die Schweiz gebracht zu werden. Eine wirkliche Heimat fand die später gegründete Familie dort nicht. Sechs von sieben Geschwistern des Rabbiners nach Israel sind gegangen, er selbst auch, mit 30 Jahren, verheiratet und zwei Kindern.
Auch über sichtbare Zeichen im Kleidungsstil wurde gesprochen, am prägnantesten natürlich die Kippa. Ob er immer eine Kippa trage, wurde Rabbiner Brukner gefragt. Seit seiner Kindheit in der Schweiz – in Kindergarten, Schule und Gymnasium – trage er sie. Auch in seiner Münchner Zeit (2008-18) gehörte sie zu seinem Alltag. Mittlerweile trägt er draußen eine Mütze über der Kippa.
Die Schülerinnen und Schüler verglichen eigene religiöse Erfahrungen mit dem Judentum: Glaube man auch an Gott und Propheten? Die Gegenfrage könnte lauten: Ihr auch?, erwiderte augenzwinkernd der Rabbiner. Die göttliche Offenbarung bei der Spaltung des Roten Meeres und am Berg Sinai ist 3.500 Jahre her, also viel länger, als durch den Juden namens Jesus vor 2.000 Jahren und Mohammed vor 1.400 Jahren zwei weitere Weltreligionen begründet wurden. Moses sei der wichtigste Prophet im Judentum; die Zeit der Propheten wurde vor 2.500 Jahren beendet.
Die Frage nach dem Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern brannte einem Jugendlichen dann doch auf den Nägeln. Ein Thema, das sich nicht mit einer kurzen Antwort erörtern lässt. Der Rabbiner erklärte den Staat Israel für die Juden als ein Wunder, das Zusammenleben ermöglicht. Seit der Zerstörung des Tempels durch die Römer vor 2.000 Jahren sei das Volk in der Welt zerstreut. Außerdem sei es für Juden in Deutschland eine Art Lebensversicherung, die zurzeit der Shoa nicht existiert habe. Die Konflikte zwischen Israelis und Palästinensern, aber auch unter Israelis selbst seien nicht zu leugnen. Rabbiner Brukner glaubt fest daran, dass sich alle Konflikte lösen ließen, wenn man aus der Geschichte heraus verstehe, wie sich die Dinge entwickelt haben.
„Wilna und Israel sind meine Heimat, Deutschland meine Aufgabe“ – die Zeitzeugin Tamar Dreifuss über Erinnern und Lernen aus der Vergangenheit
Tamar Dreifuss gehört zu den wenigen direkten Zeitzeugen, die noch von der Shoa berichten können. Sie ist jetzt weit in den Achtzigern, hat die Schrecken als Kind im Grundschulalter erlebt, aber spricht fest und klar vor den Schülerinnen und Schülern. Das mitunter vorhandene Grundrauschen einer großen Gruppe von Jugendlichen verstummte, als sie von ihrer Höllenfahrt berichtete: aus behüteten Verhältnissen in Wilna, dem heute litauischen Vilnius, zunächst in Zufluchtsstätten, dann ins Ghetto, zuletzt in Lager, die dazu bestimmt waren, die endgültige Deportation der verfolgten Juden in die Vernichtungslager vorzubereiten. Dort gelang ihrer mutigen Mutter in einer abenteuerlichen Aktion mit ihr zu fliehen und sich bis zum Eintreffen der Roten Armee zu verstecken.
Vor dem Hintergrund zweier israelischer Flaggen berichtet sie von der glücklichsten Zeit ihres Lebens, als sie nach dem Krieg in Israel angekommen ist, sich endlich sicher unter Jüdinnen und Juden fühlen konnte und auflebte. Israel aber blieb ein kurzer Traum, denn aus Liebe folgte sie ihrem deutschjüdischen Ehemann widerwillig nach Deutschland, das sie nie wieder betreten wollte. „Hassen Sie die Deutschen?“, fragte ein Mädchen, und sie gab die nachdenklich machende Antwort: „Ja, ich habe sie damals gehasst, aber jetzt hasse ich anders!“ Totenstille im Raum.
Sie hat ihre Traumata produktiv gemacht, hat die Aufzeichnungen ihrer Mutter herausgegeben, ein Kinderbuch über die Shoa aus Sicht ihres damaligen Kindseins geschrieben, ist Erzieherin für jüdische Kinder geworden und erzählt in Schulen ihre Geschichte. „Ein Tropfen auf den heißen Stein!“, sagt sie, „aber aus vielen Tropfen kann ein Meer werden!“ Deutschland sei ihre Aufgabe, nicht ihre Heimat, und damit sprach sie wohl manchen der jungen migrantischen Zuhörerinnen und Zuhörern aus der Seele.
Es war ein inhaltsreicher Vormittag, der in eine Mittagspause im Garten der Synagoge mündete. Das Erlebte und Gehörte konnte nun erst einmal in persönlichen Gesprächen reflektiert werden, umrahmt von der koscheren Küche des Restaurants „Mazal Tov“. Gemeinsam sitzen und reden, die Sonne und das Essen genießen – fast hätte man glauben können, in Tel Aviv zu sein. Aber die Luft sei dort eine andere, merkte Tamar Dreifuss an.
Gut gestärkt ging es anschließend in die Workshops und die Führungen durch den Gebetsraum.
Er hat was von einer Kirche…
… der Gebetsraum der Synagogengemeinde Köln. Die 1938 von den Nationalsozialisten zerstörte Synagoge wurde in den 1950er Jahren aufgebaut. Seit 1959 kann hier wieder jüdisches Leben stattfinden. Doch die Kenntnisse zu jüdischer Symbolik und Architektur waren nach der Shoa in Deutschland nicht mehr weit verbreitet. So erinnert die Architektur an die Schiffsaufteilungen in christlichen Kirchen, in den Fenstern verstecken sich eher christliche Deutungen wie z.B. die Friedenstaube. David Klapheck, Geschäftsführer der Gemeinde, beantwortete den Jugendlichen fachkundig und lebendig viele Fragen, zeigte ihnen die Thora-Rollen, erklärte den Ablauf von Gottesdiensten, Beerdigungen und Hochzeiten.
Der Weg in den Gebetsraum führt durch die Trauerhalle. 6 Millionen Juden wurden während der Shoa umgebracht, darunter 10.000 Kölnerinnen und Kölner. An ihr Schicksal erinnert dieser Ort der Stille, in dem man die berühmte Stecknadel hätte fallen hören können, als David Klapheck aufgrund seiner persönlichen Familiengeschichte den Jugendlichen zeigte, warum diese Zeit noch immer nicht vorbei sei. Er wünsche sich, dass wenigstens die Generation seiner Kindeskinder nicht mehr den persönlichen Schmerz der jeweiligen Elterngeneration erfahren müsse.
Tanzen, Stadtführung, Antisemitismus und Jugendkultur
Die Abschlusspräsentation im Gemeindesaal gab allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen umfassenden Einblick in die Workshops.
Workshop 4: Jung – jüdisch – vielfältig. Junge jüdische Lebenswelten in Deutschland, Israel und USA
Gedenken und Erinnern, vor allem an die Shoa, sind zentrale Bestandteile des Judentums, und die Thematisierung dieses singulären Menschheitsverbrechens ist auch fest in den Lehrplänen deutscher Schulen verankert. Doch wie leben junge jüdische Menschen gegenwärtig, hier und heute, in Deutschland und der Welt? Welche Erfahrungen machen sie im Alltag? Welche Themen bewegen sie? Prädestiniert dafür solche Fragen zu beantworten, ist Ma’ayan Bennett, 22 Jahre, Tochter einer jüdischen Mutter mit deutschen Wurzeln und eines amerikanischen Juden, in Israel geboren und mit sieben Jahren nach Deutschland gezogen. In ihrem Workshop berichtete sie den Schülerinnen und Schülern aus ihrem Leben, teilte ihre Erfahrungen und stellte sich den Fragen der Teilnehmenden. Ma’ayan Bennett, die sich aktiv für die Stärkung jüdischer Identitäten einsetzt und feministisch engagiert, berichtete vom Leben in der Mehrheitskultur in Israel, in der Jüdischsein normal sei, wo man sich zuhause und sicher fühle, was vor allem auch das eigene Selbstbewusstsein stärke. Das „Kontrastprogramm“ dazu sei das Leben in der deutschen Diaspora, dem „Land der Verbrecher“; hier könne man deutliche Unterschiede in der jüdischen Kultur erkennen, da man sich zwar einerseits an der israelischen Leitkultur orientiere, viele Menschen andererseits allerdings auch sehr assimiliert lebten. Die USA böten teilweise andere Entfaltungsmöglichkeiten für Juden, was dort stellenweise zu einem Aufblühen einer neuen jüdischen Kultur führe. Die logischerweise junge jüdische Identität in Deutschland müsse sich hingegen erst noch finden. Ma’ayan Bennett schätzt an Deutschland vor allem, dass man sich hier dezidiert mit der Vergangenheit auseinandersetze. Dies gebe ihr ein größeres Sicherheitsgefühl als in anderen europäischen Ländern. „Hier kann ich Gehör finden, etwa bei Veranstaltungen wie heute.“
Neben der Beantwortung zahlreicher konkreter Fragen der Teilnehmenden stellte Ma’ayan Bennett auch selbst Fragen an die Schülerinnen und Schüler. Diese sollten sich in Gruppen mit „Identität“ und „Solidarität“ beschäftigen. Für Ma’ayan Bennett ist gegenseitiges Kennenlernen und Verständnis essentiell – nur durch das Verständnis der jeweiligen Lebensrealitäten könne wirkliche, effektive Solidarität erfolgen.
Workshop 3: Antisemitismus in den Lebenswelten von Jugendlichen
Sebastian Werner und Maj Ceesay von der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit e. V zeigten anhand des Films „MASEL TOV COCKTAIL“ auf unterhaltsame und selbstironische Weise eine Vielzahl von vielfältigen Facetten rund um das Jüdischsein in Deutschland. In Verbindung von historischen Fakten hin zur subjektiven Erfahrungswelt eines jungen Menschen zeigt der Film Vorurteile und Antisemitismus, aber auch übertriebene Betroffenheitssympathien von Menschen, die sich in political correctness verrennen. Er erzählt die Geschichte des Jungen Dimi, der ebenso wenig die Geschichte miterlebt hat wie andere aus seiner Generation, diese aber ständig vor Augen gehalten bekommt. Der Film spricht das Publikum direkt an und fordert dazu auf, über das Problem nachzudenken. Die Klischees, die in den Köpfen der Menschen verankert sind, werden immer wieder in überraschende und originelle Bildideen verpackt. MASEL TOV COCKTAIL bringt historische Fakten und aktuelle Themen zusammen, zeigt bis zum Schluss kein Opferdenken. Dieses konsequente und authentische Stimmungsbild unserer Gesellschaft und der Aufruf zu einem respektvollen Miteinander war auch eine der Beobachtungen der Jugendlichen dieses Workshops. Diese kamen im weiteren Verlauf des Workshops ins Gespräch zu den einzelnen Szenen des Filmes und es entstand ein angeregter Austausch über Äußerungen im Film, bei denen die Jugendlichen eigene Erfahrungen einfließen lassen konnten. Insgesamt hat der Workshop die Jugendlichen für das Thema Antisemitismus sensibilisiert und das von Vorurteilen geprägte gesellschaftliche Bild vom Jüdischsein problematisiert.
Workshop 2: Stadtrundgang „1700 Jahre jüdisches Köln“
Die jüdische Gemeinde der Stadt ist die älteste, die nördlich der Alpen urkundlich belegt ist. Das geht aus einem Edikt von Kaiser Konstantin aus dem Jahr 321 hervor. Über Jahrhunderte hinweg haben jüdische Einwohner den Aufstieg Kölns geprägt. Irena Okoh nahm die Jugendlichen mit auf die Spuren des alten jüdischen Köln. Am Dom konnten sie sowohl die von Salomon Oppenheim jr. gestifteten Fenster, aber auch die von Steinmetzen angefertigten antijüdischen Symbole wie die „Judensau“ nachvollziehen. Über einen Stopp an der Ausgrabungsstätte „MiQua - LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln“ wanderte der Blick zum Turm des Rathauses, dort tauchte Oppenheim wieder als Steinfigur auf, mit den Bauplänen der Synagoge in der Hand – deutliche Hinweise, wie sehr er sich für das jüdische Leben in Köln eingesetzt hat. Zum Abschluss des Rundgangs entdeckten die Jugendlichen eine Gedenkplakette für Max Bodenheimer, einem Begründer des deutschen Zionismus.
Workshop 1: Israelischer Tanz
Lebensfreude, Tanz und Gemeinschaft zeigte Marina Cohen den Jugendlichen – und allen Zuschauenden – mit der Choreographie eines israelischen Tanzes. Ein fulminanter und fröhlicher Abschluss eines erkenntnisreichen, nachdenklich stimmenden, aber auch Gemeinsamkeiten und in die Gegenwart und Zukunft blickenden Tags.