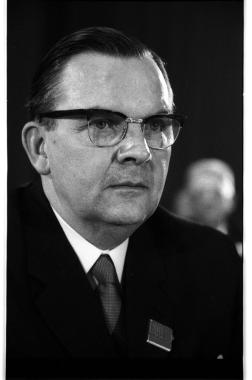Familiärer Hintergrund, prägende Einflüsse und Werdegang bis 1933
Josef Hermann Dufhues wurde am 11. April 1908 in Castrop-Rauxel geboren. Hier wuchs er zusammen mit vier Geschwistern als Sohn eines Spediteurs auf, der um 1900 aus dem westfälischen Beckum ins Herzen des Ruhrgebiets gekommen war. Die westfälische Heimat und der Katholizismus prägten ihn nachhaltig. Heinrich Köppler hat Dufhues wegen seiner Geradlinigkeit, Grundsatztreue und Akribie bei der Erledigung aller seiner Aufgaben als „die beste Ausgabe des westfälischen Typus, den man sich denken kann“, beschrieben. Zugleich war er mit seinem ganzen Wesen in der katholischen Weltanschauung verwurzelt, ohne deshalb klerikal zu sein, auch wenn er in der Öffentlichkeit bisweilen als „militanter Katholik“ abgestempelt wurde. Dieses ihm angehängte Klischee hat er teils mit Lächeln, teils mit Spott ertragen. Dagegen empfand er die Bezeichnung „Jesuit in Zivil“, die ihm Wolfgang Döring, sein langjähriger Gegenspieler von der FDP in der nordrhein-westfälischen Landespolitik, gegeben hatte, als einen ehrenden Titel.
Dufhues strebte eine Karriere in der Kommunalverwaltung an, weshalb er nach dem Abitur am humanistischen Gymnasium in Herne 1927 in Tübingen ein Studium der Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre begann, das er in Berlin fortsetzte und abschloss. Die ursprünglichen beruflichen Pläne von Dufhues ließen sich nach der Übernahme der politischen Macht in Deutschland durch die Nationalsozialisten mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 nicht mehr verwirklichen, da er nicht bereit war, Mitglied der NSDAP zu werden.
Einstellung zum Nationalsozialismus
Über seine Einstellung zum NS-Regime äußerte sich Dufhues in einem Lebenslauf, den er nach 1945 für die Wiederzulassung als Rechtsanwalt anfertigte. Der sogenannte Röhm-Putsch war für ihn demnach ein Schlüsselereignis, das ihm die Augen über den wahren Charakter der NS-Herrschaft öffnete. In dem Lebenslauf heißt es unter anderem: „Nach den Ereignissen vom 30. Juni 1934 habe ich an den Veranstaltungen des SS-Reitersturms, wo ich sowieso wohl nur zweimal war, nicht mehr teilgenommen und die Bezahlung der Beiträge sofort eingestellt. Als mein Verhalten beanstandet wurde, erklärte ich sechs Wochen vor meiner Zulassung zur Rechtsanwaltschaft meinen Austritt. Unter Ablehnung meines Austritts wurde ich strafweise ausgeschlossen mit der Begründung: 1. Ich habe ohne Genehmigung des Reichsführers der SS geheiratet; die Einholung dieser Genehmigung hatte ich ausdrücklich abgelehnt. 2. Wegen grober Interesselosigkeit gegenüber der SS. 3. Wegen Nichtzahlung meiner Beiträge.“
Dufhues Ehefrau Maria Antoinette, genannt Annette, war die Tochter von Hans Krauß, dem letzten Pressechef der Deutschen Zentrumspartei. Für die Parteikorrespondenz von Kraus hatte er einige Beiträge geschrieben, in denen er sich an den Debatten innerhalb des politischen Katholizismus am Ende der Weimarer Republik beteiligt hatte. Für falsch, gar gefährlich hatte er zu Beginn der 1930er-Jahre Überlegungen gehalten, die innenpolitischen Verhältnisse durch eine Regierungsbeteiligung der Rechtsparteien und vor allem der NSDAP zu stabilisieren.
Gründung einer Familie und berufliche Anfänge
Die Gründung einer Familie, die 1937 mit der Geburt der Tochter Christa Maria komplettiert wurde, fiel zusammen mit dem Aufbau einer beruflichen Existenz in Berlin. Nach Referendar- und Assessorexamen war er seit 1933 in der Rechtsanwaltskanzlei von Fritz Ludwig tätig, wurde 1935 dessen gleichberechtigter Partner und war vor allem mit Fragen des Wirtschaftsrechts befasst, trat aber auch als Strafverteidiger auf. Er verteidigte sogenannte Volks- und Staatsfeinde wie den Sozialdemokraten Wilhelm Fitzner oder Verfolgte des „Jungdeutschen Ordens“.
Die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges durch Hitler am 1. September 1939 blieb auch für Dufhues und seine Familie nicht folgenlos, wenngleich er selbst erst 1941 in die 196. Infanteriedivision zum Kriegsdienst verpflichtet wurde. Darin gehörte er einer Gebirgsartillerie-Abteilung an, kam zunächst nördlich des Polarkreises und später an der Ostfront beim Rückzug im Mittelabschnitt zum Einsatz.
Der Kriegserlebnisse, vor allem die Begegnungen mit 14- bis 16-jährigen Jungen, die gegen Ende des Krieges als Nachschubarmeen an die Front geschickt wurden, prägten ihn nachhaltig. Sie veranlassten ihn schließlich, sich unmittelbar nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reiches“ politisch zu engagieren: 1945 Eintritt in die CDU, 1946/47 Mitglied des ernannten Landtags von Nordrhein-Westfalen, 1948/49 stellvertretendes Mitglied des Parlamentarischen Rates, 1946 bis 1950 Mitgründer und Vorsitzender der Jungen Union Westfalen-Lippe, 1949/50 Vorsitzender der Jungen Union Deutschlands. Dufhues zählte also zu den Männern der ersten Stunde beim staatlichen und parteipolitischen Wiederaufbau Deutschlands.
Streiter für die junge Generation
Dufhues war kein Volkstribun, der mit begeisternden Reden seine Zuhörerinnen und Zuhörer mitreißen konnte. Die Rolle des nüchternen Analytikers, der mit seiner Argumentation überzeugte, lag ihm eher, wie sein selbstbewusster Auftritt auf dem Gründungsparteitag der CDU Deutschlands in Goslar im Oktober 1950 zeigte. Dort trat er in seiner Funktion als Bundesvorsitzender der Jungen Union auf und mahnte die Entscheidungsträger im Bund und in den Ländern, wohlwollenden Worten auch Taten folgen zu lassen, um „der Jugend einschließlich der sogenannten verlorenen Generation der 30 bis 40-Jährigen den Weg zur verantwortungsbewussten Mitarbeit in den politischen Parteien, in Gemeinde und Staat zu ebnen“. Mit eindringlichen Worten schilderte er die akuten Probleme der Jugend in Deutschland zu Beginn der 1950er-Jahre. Mehr als 500.000 Jugendliche ohne Lehrstelle erforderten „unverzüglich Sofortmaßnahmen zur Schaffung von Jugendwohnungen, Jugendbildungsstätten und zur intensiven Ausnützung und verstärkten Bereitstellung von Lehr-, Anlern- und Arbeitsstellen“, denn der Erfolg dieser Bemühungen entscheide letztlich darüber, „ob die Jugend freudig unserem Staat ihr Leben und ihre Kraft weiht“.
Aufbau einer beruflichen Existenz jenseits der Politik
Dazu konnte Dufhues ab 1950 mit seinem Mandat im Landtag von Nordrhein-Westfalen einen Beitrag leisten. Drei Jahre zuvor hatte er eine Kandidatur für das Landesparlament in Düsseldorf noch abgelehnt, da er größten Wert auf den Aufbau einer gesicherten beruflichen Existenz legte, die ihn von der Politik unabhängig machte. Dabei hatte Dufhues das Schicksal seines Schwiegervaters Hans Krauß vor Augen. Nach der zwangsweisen Auflösung der Zentrumspartei hatten ihn die Nationalsozialisten mit einem Berufsverbot belegt, was Krauß in größte wirtschaftliche Bedrängnis gebracht hatte. Dufhues selbst kehrte 1945 aus Berlin in seine westfälische Heimat nach Bochum zurück, nachdem ihm der Krieg mit der Zerstörung sowohl seiner Anwaltskanzlei als auch seiner Privatwohnung die Existenzgrundlage geraubt hatte.
Vor diesem Hintergrund ist sein Verzicht auf eine Landtagskandidatur 1947 zu verstehen. Stattdessen widmete Dufhues sich seit Ende 1946 dem Aufbau seiner Anwaltskanzlei in Bochum, nachdem er zuvor als Richter beim Landgericht der Stadt tätig gewesen war. Sehr schnell gelang es ihm, sich als Rechtsanwalt über die Grenzen Bochums hinaus bekannt zu machen. Er erreichte vor dem Obersten Militärgericht in Herford einen Freispruch für sieben deutsche Arbeiter, die in erster Instanz verurteilt worden waren, da sie sich der Anordnung der Militärregierung zur Demontage des Stahlwerks Bochumer Verein widersetzt hatten.
Gründungsvater des Westdeutschen Rundfunks
Im Landtag profilierte er sich als führender Rundfunkpolitiker seiner Fraktion. Dufhues gilt als einer der Väter des WDR-Gesetzes von 1954. Mit der Gründung einer landeseigenen Rundfunkanstalt erhoffte er sich auch einen Beitrag zur Stabilisierung des noch jungen, 1946 von der britischen Besatzungsmacht gebildeten Bindestrichlandes. Deshalb müssten in den Sendungen des Westdeutschen Rundfunks „Sprache und Denken der Arbeiter unserer Berg- und Hüttenwerke, unserer Bauern und Handwerker, der Menschen des Rhein- und Weserlandes, des Sauer- und des Münsterlandes in ihrer ganzen Vielfalt und Gestaltungskraft zur Geltung kommen, wenn das Wort, das an das Ohr des Hörers dringt, seine volle Wirksamkeit entfalten soll“. Der Förderung dieses Ziels diente die Errichtung von Außenstudios in Bielefeld, Dortmund und Münster. Nicht nur in der Frage der Regionalisierung des WDR arbeitete Dufhues vertrauensvoll mit Heinz Kühn zusammen, seinem Stellvertreter im Amt des Verwaltungsratsvorsitzenden – nicht immer zur großen Freude der jeweiligen Parteifreunde, „die mehr Parteilichkeit von jedem von uns erwarteten, wo wir meinten, dass es um ein Stück notwendiger Gemeinsamkeit ginge“, erinnerte sich der langjährige sozialdemokratische Ministerpräsident in der Rückschau.
Mit Überzeugung vertrat Dufhues den öffentlich-rechtlichen Status der Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik und verteidigte ihn in entscheidenden Phasen der Nachkriegsentwicklung, was ihn während des Streits um ein bundesdeutsches Fernsehen (1958–1961) in Gegensatz zu Konrad Adenauer brachte. Der Bundeskanzler und Vorsitzende der CDU Deutschlands griff ihn scharf an, warf ihm im September 1960 gar vor, „ein Hauptgegner“ der Einheit der Partei zu sein.
Das Husarenstück von Stuttgart
Bereits auf dem Bundesparteitag der CDU in Stuttgart Ende April 1956 hatte sich Dufhues gegen Adenauer gestellt. In einer viel beachteten Rede war es ihm gelungen, den gemeinsamen Antrag der Landesverbände Rheinland und Westfalen-Lippe durchzusetzen, die Zahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden von zwei auf vier zu erhöhen und dadurch die Wahl Karl Arnolds in die Parteiführung zu ermöglichen.
Arnold war im Februar 1956 durch ein konstruktives Misstrauensvotum im Landtag von Nordrhein-Westfalen als Ministerpräsident gestürzt worden. Adenauer hatte sich gegen den Aufstieg seines innerparteilichen Rivalen in den inneren Führungszirkel der CDU gewehrt. Unerschrocken war Dufhues dem Bundeskanzler und Parteivorsitzenden entgegengetreten: „Wir sind nicht nach Stuttgart gekommen, um einen reibungslosen Verlauf des Bundesparteitages zu gewährleisten. (…) Mit äußeren Demonstrationen einheitlicher Auffassungen ist dem Herrn Bundeskanzler am wenigsten gedient. Er darf erwarten, dass wir – und ich füge hinzu, nicht nur wir – ihm mit der Achtung und der Verehrung begegnen, die in seiner Persönlichkeit, seinem Amt und seinen staatsmännischen Leistungen ihre Grundlage haben. Er muss aber auch erwarten, dass natürliche Spannungen und unterschiedliche Meinungen und Auffassungen zum Ausdruck kommen und zum Wohl der Union in gemeinsamer Verantwortung gelöst werden.“
Gescheiterte Ambitionen
Der Sturz der Regierung Arnold bedeutete für die CDU in Nordrhein-Westfalen den Gang in die Opposition, in der Dufhues zu den Hauptakteuren seiner Fraktion im Landtag gehörte. Deshalb machte er sich nach der Landtagswahl von 1958 Hoffnungen, an die Spitze des bevölkerungsreichsten Bundeslandes treten zu können. Im Sog der Bundestagswahl von 1957 erzielte die CDU bei der Landtagswahl vom 6. Juli 1958 mit einem Stimmenanteil von 50,5 Prozent einen deutlichen Wahlsieg, womit das zweijährige Zwischenspiel einer sozial-liberalen Landesregierung unter Beteiligung des Zentrums endete.
Eine Woche vor dem Wahlgang war Karl Arnold nach einem Herzinfarkt verstorben, sodass die CDU-Landtagsfraktion einen neuen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten küren musste. In einer Kampfabstimmung unterlag Dufhues deutlich Franz Meyers, dessen erfolgreiche Tätigkeit als Innenminister von 1952 bis 1956 noch in Erinnerung war und der zudem in dem Ruf eines erfolgreichen Wahlkampfmanagers stand, der Adenauers Sieg bei der Bundestagswahl 1957 organisiert hatte. Dufhues zeigte sich als fairer Verlierer und trat als Innenminister in das neue Landeskabinett ein.
Innenminister von Nordrhein-Westfalen
Zu seinen Erfolgen als Innenminister zählten eine Funktionalreform der Verwaltung, mit der zahlreiche Aufgaben aus der Landesverwaltung in die Zuständigkeit der Kreise, Städte und Gemeinden verlagert wurden, eine Verbesserung des kommunalen Finanzausgleichs zugunsten der Gemeinden, eine Beschleunigung der Verfahren zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts und Maßnahmen zur Bekämpfung der Mütter- und Säuglingssterblichkeit durch die Einführung des Mutterpasses und der Polio-Schutzimpfung.
Abseits des Ministeramtes nahm er Ende der 1950er-, Anfang der 1960er-Jahre maßgeblich Einfluss auf zwei Entscheidungen, die den Strukturwandel seiner Wahlheimat Bochum beförderten: die Ansiedlung der Adam Opel AG auf dem Gelände der im Dezember 1958 stillgelegten Zeche Dannenbaum und die Gründung der Ruhr-Universität in dem bis dahin noch weitgehend landwirtschaftlich geprägten Stadtteil Querenburg.
Seine größte Herausforderung als Innenminister hatte Dufhues zu bestehen, als die Synagogen in Düsseldorf Mitte Januar 1959 und in Köln zu Weihnachten 1959 geschändet wurden. Er ließ keinen Zweifel daran, dass die Landesregierung gegen „antisemitische Vorkommnisse mit unnachsichtiger Härte“ vorgehen werde. Zugleich betonte er im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit die Notwendigkeit stärkerer politischer Bildungsarbeit. Hier sah er „Elternhaus und Schule, Kirche und Staat“ in der Pflicht, damit vor allem die Jugend begreifen lerne, „dass der Antisemitismus mit der Würde des Menschen und den Geboten echter Toleranz unvereinbar und eines Kulturvolks unwürdig ist“.
Nach vier Jahren im Amt des Innenministers verließ Dufhues nach der Landtagswahl im Sommer 1962 die landespolitische Bühne in Düsseldorf, um in Bonn das neu geschaffene Amt des Geschäftsführenden Bundesvorsitzenden der CDU anzutreten.
Hoffnungsträger der CDU
Eine Reform der Führungsstruktur der CDU war seit 1959 virulent: die Präsidentschaftskrise hatte die Autorität Konrad Adenauers erschüttert, und in der SPD, die sich seit dem Reformparteitag von Godesberg auf dem Weg von einer Interessen- und Weltanschauungspartei zu einer linken Volkspartei befand, erwuchs den Christlichen Demokraten eine ernsthafte parteipolitische Konkurrenz. Aber erst der Ausgang der Bundestagswahl vom 17. September 1961, bei der die Unionsparteien nach Verlusten von fast fünf Prozentpunkten ihre absolute Mehrheit verloren, führte auf dem Bundesparteitag in Dortmund im Juni 1962 zu einer Neuorganisation der Parteiführung. Neben der Einrichtung eines Parteipräsidiums als geschäftsführendes Führungsorgan wurde das Amt eines Geschäftsführenden Bundesvorsitzenden geschaffen. Mit diesem neuen Amt waren hohe Erwartungen verbunden: die Partei bedurfte einer Reform an Haupt und Gliedern, um die CDU für die Zeit nach Adenauer neu aufzustellen. Der Parteitag wählte Dufhues in dieses Amt, da er in besonderer Weise geeignet schien, diese Aufgaben erfüllen zu können. Seit 1959 führte er den mitgliederstarken Landesverband Westfalen-Lippe und verfügte damit über eine beträchtliche Hausmacht innerhalb der Partei. Darüber hinaus stand er seit dem Stuttgarter Parteitag von 1956 in dem Ruf, „ein unabhängig denkender, souveräner Mann zu sein, der, ohne persönlichen Ehrgeiz, sich aufrecht für eine Sache schlug“ (Daniel Koerfer).
Dufhues war denn auch entschlossen, der Partei, die mehr als „eine Hilfsorganisation der Regierung oder ein Anhängsel der Bundestagsfraktion“ sei, „ein Eigenleben“ einzuhauchen. Doch schnell wurden ihm die Grenzen seiner Gestaltungsmacht aufgezeigt. Die Kompetenzen des Geschäftsführenden Vorsitzenden blieben unklar. Bereits wenige Wochen nach seiner Wahl in das neue Amt kam es zu einem ernsthaften Konflikt mit Adenauer, der weiterhin das Amt des Parteivorsitzenden ausübte und das Recht der Einberufung der Parteiführungsgremien für sich beanspruchte. Kompetenzgerangel mit Adenauer überschattete die fast vierjährige Amtszeit von Dufhues bis zum Bundesparteitag in Bonn im März 1966.
Bilanz eines Parteireformers
Dufhues Bilanz war durchwachsen. Nicht immer war er bei seinen Bemühungen um eine Modernisierung des Parteiapparats erfolgreich, manches blieb unvollendet. Auf der Habenseite standen der Aufbau einer Zentralen Mitgliederkartei, die Verbesserung der Parteifinanzen durch die Einführung einer Beitragsstaffel und die Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit, unter anderem durch die Schaffung des Amtes eines Pressesprechers der CDU Deutschlands. Damit schuf Dufhues nach Einschätzung von Frank Bösch „wichtige Grundlagen für den Parteiumbau“, und Wulf Schönbohm sieht in den Reformmaßnahmen, die Dufhues in den 1960er-Jahren neben Kai-Uwe von Hassel und Bruno Heck einleitete, eine Erklärung dafür, „dass die CDU in der Opposition nicht das von Adenauer und anderen befürchtete Schicksal des Zerfalls erlitt“.
Gleichwohl brachte die Amtszeit von Dufhues nicht den entscheidenden Durchbruch in der Entwicklung der CDU von der Honoratioren- und Wählerpartei zur modernen Volkspartei der Mitte. Der Grund hierfür waren nicht allein Kompetenzstreitigkeiten mit Adenauer, sondern auch und vor allem innerparteiliche Widerstände. Mandats- und Funktionsträger auf allen politischen Ebenen fürchteten bei weitreichenden Parteireformen um ihre Pfründe. Dufhues, der auf dem Bundesparteitag in Hannover im März 1964 fast flehentlich den Delegierten zugerufen hatte, dass „Parteireform nicht allein die Aufgabe des Geschäftsführenden Vorsitzenden“ sein könne, resignierte, erklärte im Januar 1966 seinen Verzicht auf eine Kandidatur für die Nachfolge Adenauers im Parteivorsitz und zog sich in die nordrhein-westfälische Landespolitik zurück.
Rückzug in die Landespolitik
Die folgenden fünf Jahre bis zu seinem Tod im März 1971 waren durch „ein wachsendes Auseinanderklaffen von Wollen und Willen“ (Hans Becker) gekennzeichnet. Die Ursache hierfür waren gesundheitliche Gründe, denn Dufhues war an einem Krebsleiden erkrankt, das zu spät diagnostiziert wurde. Da dies nicht allgemein bekannt wurde, konnte in der Öffentlichkeit das Bild vom „Zauderer im Vorhof der politischen Macht“ entstehen, das Georg Schröder, der langjährige Leiter des Büros der Tageszeitung Die Welt in Bonn von Dufhues zeichnete.
Von Zaudern konnte im April 1966 nicht die Rede sein, als Dufhues beherzt nach dem Amt des Landtagspräsidenten von Nordrhein-Westfalen griff. Nach persönlichen Verfehlungen hatte Wilhelm Johnen von diesem Amt zurücktreten müssen. Doch nach nur einem Vierteljahr musste Dufhues dieses Amt wieder abgeben, da nach der Landtagswahl vom 10. Juli 1966 die SPD als stärkste Fraktion die Parlamentspräsidentschaft für sich beanspruchen konnte.
Die Neuauflage der CDU/FDP-Koalition in Düsseldorf mit der hauchdünnen Mehrheit von 101 zu 99 Stimmen erfolgte aus bundespolitischen Gründen, um der angeschlagenen christlich-liberalen Bundesregierung von Ludwig Erhard das politische Überleben zu sichern. Nach dem Bruch der CDU/FDP-Koalition in Bonn Ende Oktober 1966 war die Geschäftsgrundlage für das christlich-liberale Regierungsbündnis in Nordrhein-Westfalen nicht mehr gegeben. FDP und SPD verständigten sich auf die Bildung einer neuen Regierung. Wie zehn Jahre zuvor Karl Arnold wurde am 8. Dezember 1966 Franz Meyers durch ein konstruktives Misstrauensvotum gestürzt.
Zwischen Triumph und Niederlage
Die CDU musste sich in der Opposition neu aufstellen. Auf einer gemeinsamen Delegiertenversammlung der Landesverbände Rheinland und Westfalen-Lippe im Essener Saalbau am 21. Oktober 1967 setzte sich Dufhues bei der Kür des Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 1970 gegen seinen alten Rivalen Meyers durch. Es war ein strategischer Fehler, die Annahme der Spitzenkandidatur nicht mit dem Amt des Vorsitzenden der Landtagsfraktion verknüpft zu haben. Dadurch überließ er die politische Bühne im Landtag dem Fraktionsvorsitzenden Wilhelm Lenz, der ihm die Rolle des Oppositionsführers streitig machte. Zermürbt von politischen Grabenkämpfen und gesundheitlich schwer angeschlagen, erklärte Dufhues am 16. Dezember 1968 seinen Verzicht auf die Spitzenkandidatur der CDU bei der Landtagswahl 1970. Es folgten zwei bittere Niederlagen: auf dem Bundesparteitag in Mainz im November 1969 scheiterte er bei der Wiederwahl in das Parteipräsidium, und nach der Landtagswahl vom 14. Juni 1970 musste er sich bei der Nominierung des Kandidaten der CDU für das Amt des Landtagspräsidenten Wilhelm Lenz geschlagen geben. Daraufhin stellte er im November 1970 auch „sein liebstes politisches Amt“ (Walter Fischer), den Vorsitz der CDU Westfalen-Lippe, zur Verfügung.
Am 26. März 1971 erlag Josef Hermann Dufhues im Alter von erst 62 Jahren seinem Krebsleiden, beschleunigt durch einen tropischen Infekt, den er sich kurz zuvor während einer Geschäftsreise ins südliche Afrika zugezogen hatte.
Das Andenken an Dufhues verblasste schnell. Eine „gründliche und umfassende Würdigung“, wie sie Hans Becker, der Dufhues zwei Jahrzehnte lang journalistisch begleitet hatte, bereits 1981 anmahnte, steht nach wie vor aus. Wie seine westfälischen Weggefährten Johannes Gronowski und Lambert Lensing zählt er zu den vergessenen Christlichen Demokraten der ersten Stunde.
Ein Politiker mit NS-Vergangenheit?
Mehr als vier Jahrzehnte nach seinem Tod gelangte Dufhues im Frühjahr 2014 wieder in das Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit. Die Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt Bochum erhob den Vorwurf, Dufhues sei ein „SS-Mann und Nazi-Helfer“ gewesen. Dabei stützte sie sich auf die im Jahr 2009 von dem früheren Landtagsmitglied Rüdiger Sagel beziehungsweise dem nordrhein-westfälischen Landesverband der Linkspartei herausgegebene Studie „60 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das vergessene braune Erbe“ des Historikers Michael C. Klepsch. Auslöser der Debatte über die vermeintliche NS-Vergangenheit von Dufhues war ein Antrag der Bochumer CDU-Stadtratsfraktion zur Umwandlung seiner Grabstätte in ein offizielles Ehrengrab der Stadt Bochum.
Dufhues ist kein aktiver Widerstandskämpfer gewesen, ebenso wenig war er aber auch ein Parteigänger der Nationalsozialisten. Er war zu keinem Zeitpunkt Mitglied der NSDAP und gehörte vorübergehend einer SS-Teilorganisation an, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges als eine nicht verbrecherische Organisation eingestuft worden ist. Zudem ist belegt, dass er Regimegegner vor Gericht vertrat. Schließlich bewegte er sich als Schwiegersohn von Hans Krauß in einem familiären Umfeld, das dem NS-Regime distanziert gegenüberstand.
Der Historiker Guido Hitze hat sich eingehend mit den Vorwürfen gegen Dufhues befasst, insbesondere mit der Anschuldigung, dieser sei nach 1945 ein „Nazi-Helfer“ gewesen. Für Hitze zeigt der „Fall Dufhues“ exemplarisch, „wie leicht es möglich ist, Parteien und ihre Repräsentanten auch nach Jahrzehnten noch mit Hilfe geschichtspolitisch motivierter Vorwürfe auf der Basis pseudowissenschaftlicher, einseitiger und einem reinen Quellenpositivismus frönender ‚Forschungen‘ zu diskreditieren, in die Defensive zu zwingen und in eine ‚rechte‘, antidemokratische Ecke zu stellen“.
Mensch mit Mut und Format
In Erinnerung bleibt Josef Hermann Dufhues als ein Mensch mit Mut und Format, wie ihn Heinrich Köppler auf der Trauerfeier am 31. März 1971 beschrieben hat: „Josef Hermann Dufhues wird uns Vorbild bleiben in seiner Auffassung, seiner praktisch gelebten Auffassung. Mit seinem nüchternen Realismus, seiner Grundsatzfestigkeit, seiner Aufgeschlossenheit für Neues. Ich glaube, Josef Hermann Dufhues hat (…) deutlich gemacht, durch sein Wirken, dass Politik bei aller Taktik sich fernhalten kann von Tiefschlägen, dass Politik nicht einen Charakter verderben muss, sondern einen Charakter verlangt. Vorbild wir er uns bleiben in seinem Mut, seinem mutigen Einsatz gerade in Situationen und vor Aufgaben, vor denen manche andere schon weglaufen wollten. (…) Josef Hermann Dufhues hat versucht, sein Leben hindurch ein Christ zu sein, und er hat aus diesem seinem Christentum die eigentlichen Antriebskräfte für sein politisches Handeln gewonnen. Für ihn war politische Verantwortung eine besondere Form Caritas, von christlicher Nächstenliebe, für eine Vielzahl von Menschen, von denen man nur einen ganz kleinen Teil persönlich kennt. Auch in dem war er und bleibt er für uns ein Vorbild.“
Lebenslauf
- 11.4.1908 geboren in Castrop-Rauxel, römisch-katholisch, Volksschule, Humanistisches Gymnasium in Herne
- 1927 Abitur, anschließend Studium der Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre in Tübingen und Berlin
- 1935 Rechtsanwalt in Berlin
- 1941–1945 Kriegsdienst
- 1945 Eintritt in die CDU
- 1945–1946 Richter am Landgericht Bochum
- 1946 Rechtsanwalt in Bochum, seit 1951 zugleich Notar
- 1946–1950 Mitgründer und Vorsitzender der Jungen Union Westfalen-Lippe
- 1946–1947 Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen
- 1948–1949 Stellvertretendes Mitglied des Parlamentarischen Rates
- 1949–1950 Vorsitzender der Jungen Union Deutschlands
- 1950–1971 Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen
- 1955–1971 Vorsitzender des Verwaltungsrates des Westdeutschen Rundfunks
- 1958–1962 Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen
- 1959–1970 Vorsitzender der CDU Westfalen-Lippe
- 1962–1966 Geschäftsführender Vorsitzender der CDU Deutschlands
- 19.4.1966–25.7.1966 Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen
- 1966–1969 Mitglied des Präsidiums der CDU Deutschlands
- 11.4.1971 gestorben in Duisburg-Rheinhausen
Literatur
- Walter Fischer: Josef Hermann Dufhues, in: Walter Först (Hrsg.): Raum und Politik (Beiträge zur neueren Landesgeschichte des Rheinlandes und Westfalens 6), Köln-Berlin 1977, S. 197–208.
- Hans Becker: Josef Hermann Dufhues, in: Walter Först (Hrsg.): Land und Bund (Beiträge zur neueren Landesgeschichte des Rheinlandes und Westfalens 9), Köln 1981, S. 194–209.
- Wulf Schönbohm: Die CDU wird moderne Volkspartei. Selbstverständnis, Mitglieder, Organisation und Apparat 1950–1980 (Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte 7), Stuttgart 1985.
- Daniel Koerfer: Kampf ums Kanzleramt. Erhard und Adenauer, 2. Auflage Stuttgart 1988.
- Frank Bösch: Die Adenauer-CDU. Gründung, Aufstieg und Krise einer Erfolgspartei 1945–1969, Stuttgart-München 2001.
- Stefan Marx: Franz Meyers 1908–2002. Eine politische Biographie (Düsseldorfer Schriften zur Neueren Landesgeschichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens 65), Essen 2003, S. 177–185, 291–293, 439–443 und 452–458.
- Johann Paul: Debatten über Nationalsozialismus und Rechtsextremismus im Landtag Nordrhein-Westfalen von 1946 bis 2000 (Schriften des Landtags Nordrhein-Westfalen 14), Düsseldorf 2003.
- Guido Hitze: „Kein Ehrengrab für den SS-Mann und Nazi-Helfer“. Anmerkungen zur Kontroverse um die angebliche NS-Vergangenheit des CDU-Politikers Josef Hermann Dufhues, in: Historisch-Politische Mitteilungen 22 (2015), S. 231–251.