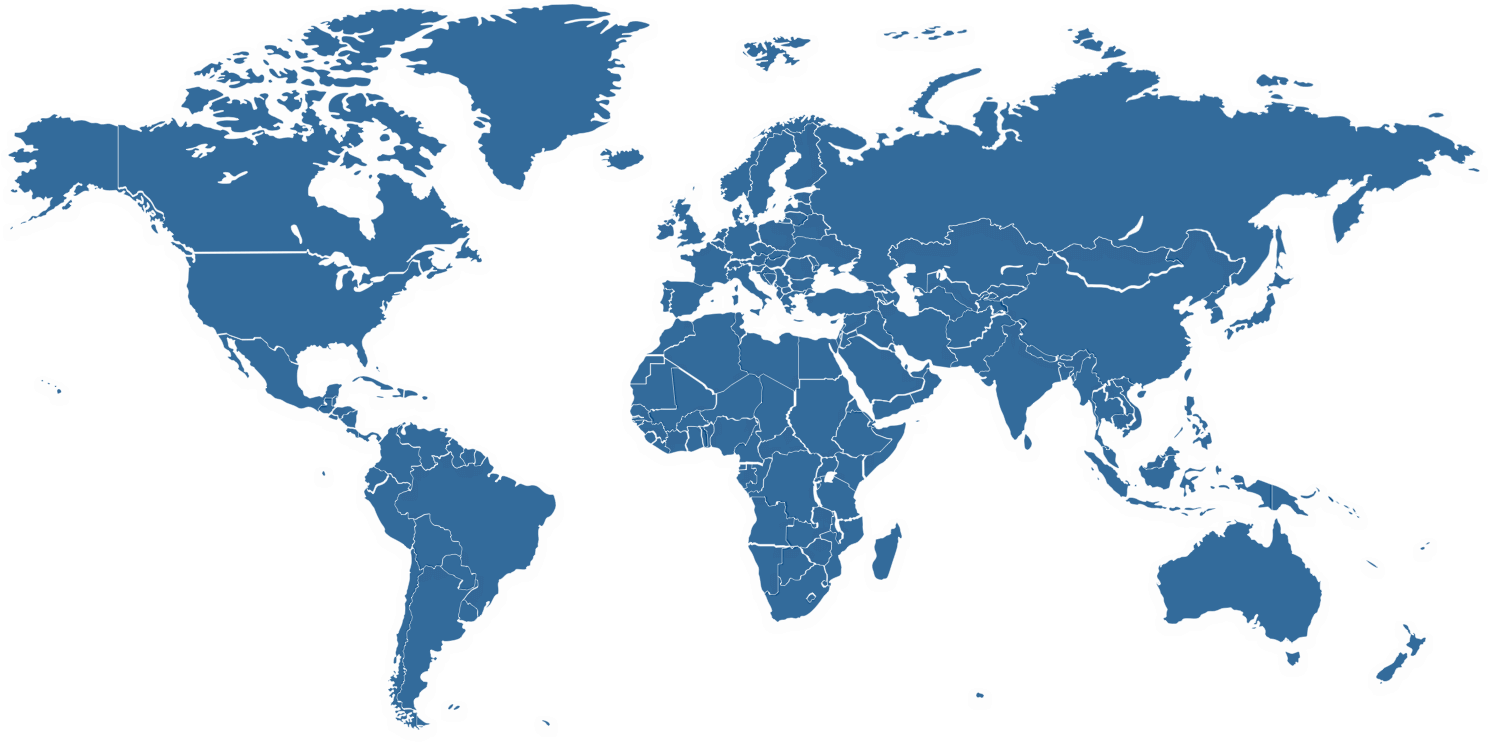Es gibt Themen in der deutschen Bildungspolitik, die lassen den öffentlichen Erregungspegel regelmäßig und kräftig steigen, die Debatten um Schulformen zum Beispiel. Und es gibt solche, die sind weit weniger schlagzeilenträchtig, zum Beispiel der Gegenstand dieser Publikation, der Einstieg in die Ausbildung für Jugendliche ohne zureichende Berufsreife. Der unterschiedliche publizistische Rang dieser beiden Fragen ist keineswegs proportional zu ihrer Bedeutung für die Qualität von Bildung und Ausbildung in Deutschland, für den Zusammenhalt der Gesellschaft und für die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft. Knapp 1,5 Millionen junge Menschen zwischen 25 und 34 Jahren haben heute keinen Berufsabschluss, ca. 150.000 junge Menschen starten Jahr für Jahr ohne Ausbildung in den Arbeitsmarkt. Für unser Land wird sich angesichts von Fachkräftemangel und Demografie vieles daran entscheiden, ob es gelingt, diese Herausforderung zu meistern. Vor allem aber steht hier ein prägen-des gesellschaftspolitisches Leitbild zur Debatte, das für die meisten Menschen ohne Berufsabschluss ein realitätsfernes Versprechen bleibt, der Aufstieg durch (Aus-)Bildung.
Das Problem hat viele Facetten. Familiäre Vernachlässigung, soziale Verwerfungen, Sprach- und Integrationsdefizite, schulische Mängel, Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt – in jedem Einzelfall spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Es ist richtig, hier an der Wurzel anzusetzen: zum Beispiel mit Erziehungshilfen, mit frühkindlicher Bildung und Sprachförderung, mit besonderen schulischen Anstrengungen in sozialen Brennpunkten. Das braucht einen langen Atem und muss begleitet werden von einem neuen Ansatz für die jungen Menschen, die heute und morgen mit Aus-bildungslosigkeit konfrontiert sind. Die Demografie allein wird das Problem nicht verschwinden lassen, aber sie bietet einen weiteren starken Anreiz, mit System den Übergang in usbildung wirksamer zu gestalten. Wenn es ein „Fenster der Gelegenheit” für nachhaltige Fortschritte gibt, dann ist es jetzt offen.
Es ist nicht so, dass bislang nichts getan wurde. Im Gegenteil: Die Vielfaltder Maßnahmen, Instrumente und Modellversuche ist kaum mehr zu überschauen. Bund, Länder, Kommunen, Arbeitsagenturen, Schulen, Kammern und Unternehmen haben viel Geld und Energie investiert. Vorbildliches ehrenamtliches Engagement zeigt sich in den zahlreichen lokalen Initiativen, die sich um den Übergang in Ausbildung kümmern. Darunter finden sich auch großartige Erfolgsgeschichten und wichtige Erfahrungen, was funktioniert und was nicht. Der Wechsel in praxis-geprägte Bedingungen ist in der Regel wirksamer als eine Verlängerung der schulischen Lernumgebung, betriebsnahe Ansätze günstiger als andere Wege, abschlussbezogene Maßnahmen besser als nur ausbildungsvorbereitende. Trotz mancher Fortschritte ist der Erfolg in der Breite ausgeblieben, Ökonomen bescheinigen dem System Ineffizienz bei hohen Kosten, Bildungsforscher sehen in den Brücken zur Ausbildung eher Sackgassen, Pädagogen und Ausbilder beklagen, viele junge Menschen in diesen sogenannten Warteschleifen seien danach nicht gestärkt, sondern geschwächt.
Für die Konrad-Adenauer-Stiftung ist das Grund genug, sich an der Suche nach neuen Strategien zu beteiligen. Dazu ist diese Publikation ein Auftakt.
Inhalt
| Vorwort Michael Thielen |
7 |
| Der schwierige Weg zum Azubi: Verschiedene Facetten des Themas Christine Henry-Huthmacher |
11 |
| I. Analyse | |
| Einblicke in den Schulalltag Fröbelschule Bochum-Wattenscheid Christoph Graffweg |
30 |
| Einblicke in den Schulalltag Kepler-Oberschule Berlin-Neukölln Wolfgang Lüdtke |
38 |
| Die Bedeutung sozialer Herkunft, Familie und Peers für die Schullaufbahn Jutta Ecarius |
49 |
| Zur Situation Jugendlicher ohne Ausbildungsreife Empirische Kenntnisse und Perspektiven Thomas Rauschenbach |
63 |
| In der Warteschleife Zur Bedeutsamkeit und Wirksamkeit von Bildungsgängen am Übergang Schule-Berufsausbildung Ursula Beicht |
73 |
| Junge Erwachsene ohne Berufsabschluss Robert Helmrich, Elisabeth M. Krekel |
86 |
| Im Zeichen demografischen Wandels Neue Perspektiven für den Übergang in die Berufsausbildung Martin Baethge |
107 |
| Direkte und indirekte Kosten mangelnder Ausbildungsreife in Deutschland Dirk Werner |
125 |
| II. Erfolgreiche Modelle zur Berufsbefähigung: Schule | |
| Erfolgskonzept: Frühe Berufsorientierung Weißfrauenschule, Sprachheilschule der Stadt Frankfurt am Main Jens Bachmann |
148 |
| Einen Kontrapunkt setzen: Musik als Schlüssel zum Erfolg Die Musikhauptschule Ruhstorf a.d. Rott Josef Bertl |
161 |
| Erfolgsfaktor: Erziehungsziele Die Friedrich-Ebert-Schule, Frankenthal Heidrun Kohl |
168 |
| BERUFSSTART plus Ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener Thüringer Institutionen Petra Bürger |
177 |
| Bei der Vorbereitung auf den Beruf früh an einem Strang ziehen Eltern – Sozialpädagogen – Schule – Betriebe – Agentur für Arbeit: Der Verein Jugendhilfe Direkt e.V., Münster Hans-Werner Kleindiek |
188 |
| Angst vor der Arbeitswelt nehmen Neues Berufsbefähigungsprojekt für Kinder ab zehn Jahren: Lichtblick Hasenbergl, München Johanna Hofmeir, Dörthe Friess |
200 |
| III. Erfolgreiche Modelle zur Berufsbefähigung: Ausbildung | |
| Teilzeitberufsausbildung – Eine Chance für junge Mütter und Väter Die Arbeitsförderungsinitiative RE/init e.V. Kerstin Degener-Kirsch |
212 |
| Integration in ein selbstbestimmtes Leben Das BildungsWerk in Kreuberg, Berlin Nihat Sorgec |
221 |
| Nachbesserung der Ausbildungsreife durch Betriebe Nicole Stab, Christoph Herbrig, Winfried Hacker |
229 |
| Normalität statt Massnahme Assistierte Berufsausbildung für chancenarme junge Menschen Ralf Nuglisch |
238 |
| IV. Strukturelle Konsequenzen | |
| Wege zur Teilhabesicherung für benachteiligte junge Menschen am Bildungs- und Ausbildungssystem Birgit Fix |
252 |
| Neue Wege auf kommunaler Ebene Der Ansatz ILJA in Nordrhein-Westfalen Roland Matzdorf |
261 |
| Neue Herausforderungen, neue Rollen, neue Ansätze Helmut Westkamp |
269 |
| Auswege aus dem Labyrinth des „Übergangssystems” Stefan Sell |
287 |
| Nachwort: Prozesse des Erwachsenwerdens anleiten und gestalten Elisabeth Hoffmann |
314 |
| Schlusswort: Die Verantwortung der Politik Annegret Kramp-Karrenbauer |
335 |