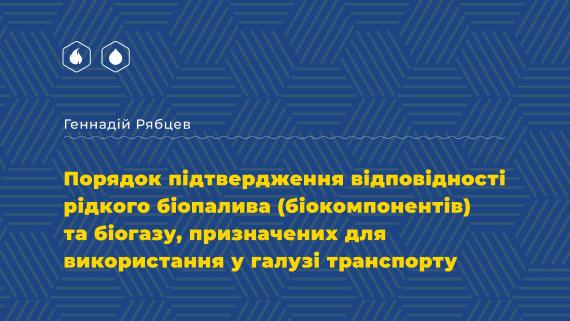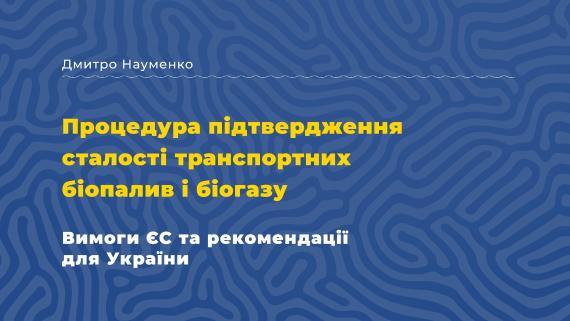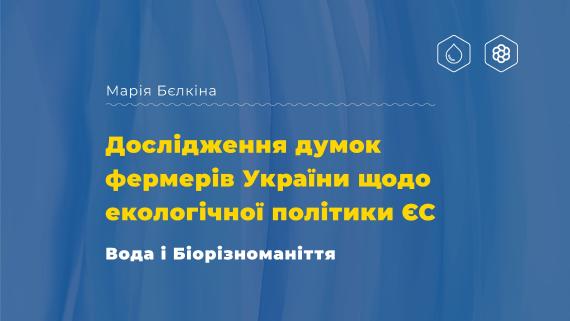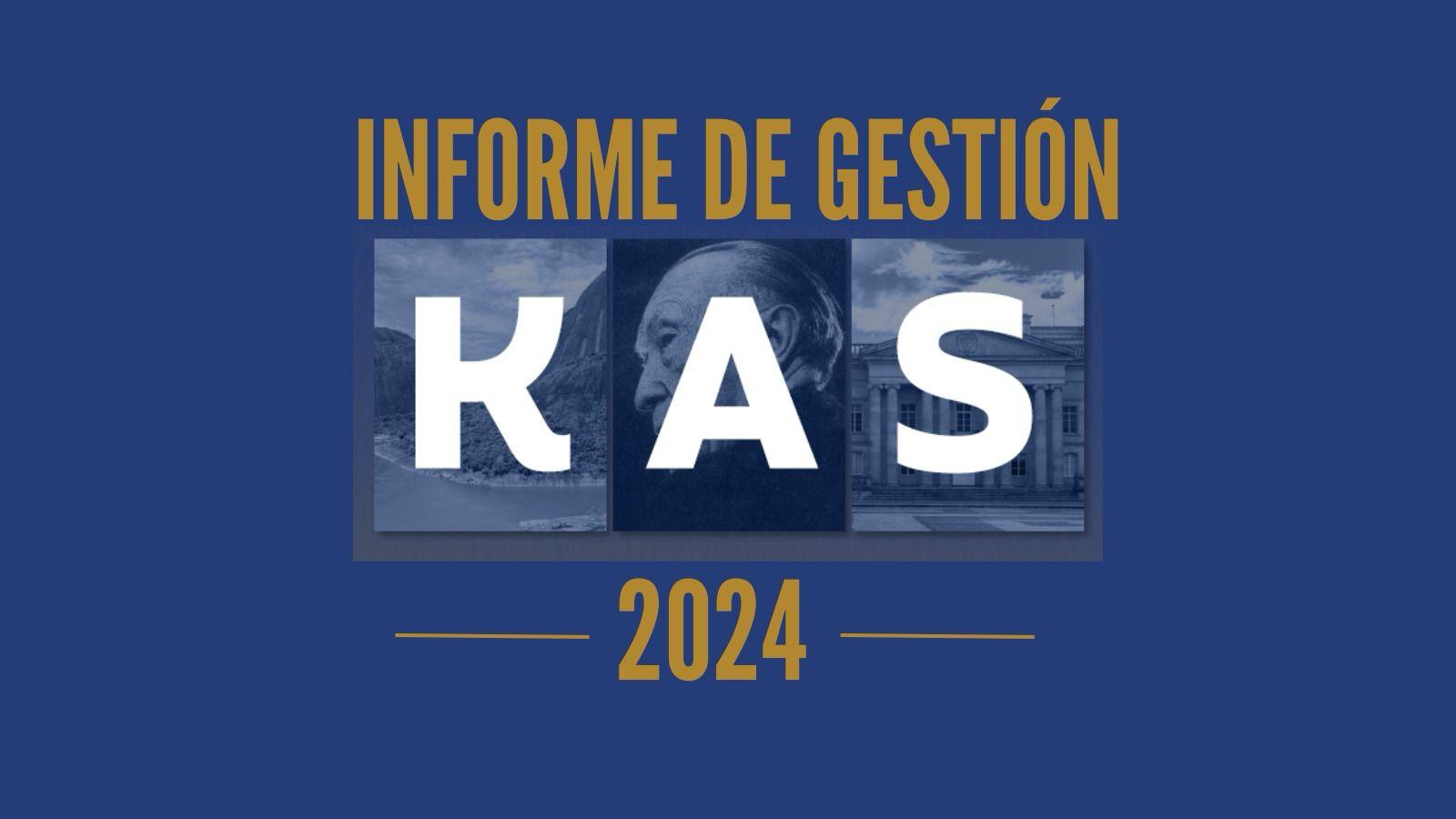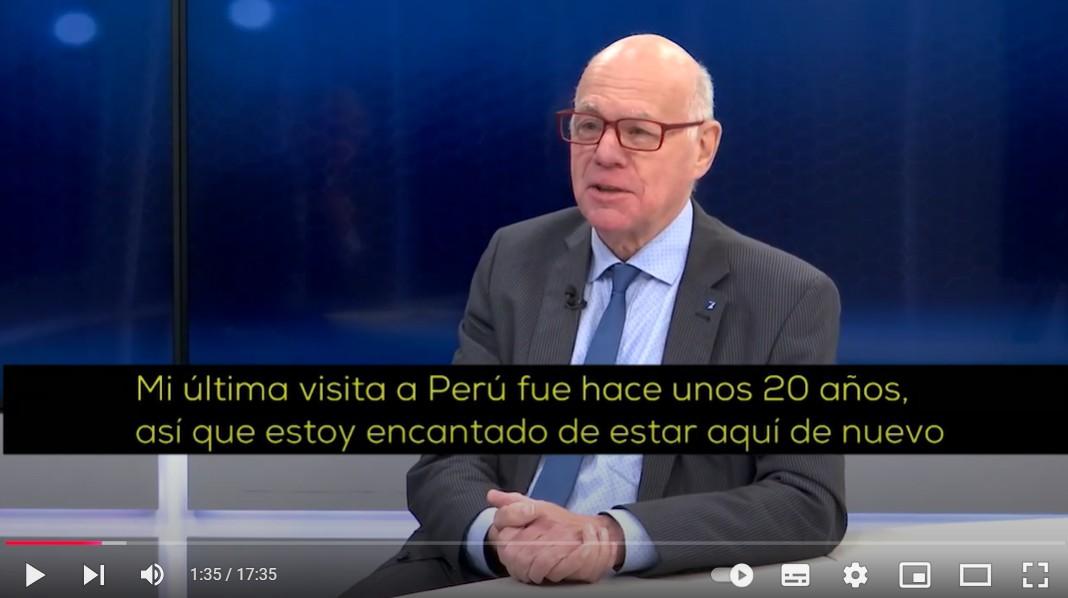Wir retten das Klima nur in einer intelligenten gemeinsamen Kraftanstrengung von Politik und Wissenschaft.
Auf einen Blick
- Eine nachhaltige Entwicklung bringt ökonomische, ökologische und soziale Aspekte zusammen. Das Eintreten für mehr Nachhaltigkeit bedeutet daher vor allem die Übernahme von Verantwortung für die Zukunft.
- Innovative Technologien, Verfahren und Verhaltensänderungen können perspektivisch ein wichtiger Schlüssel für den nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen und unseren natürlichen Lebensgrundlagen sein.
- Ein Wandel zu mehr Nachhaltigkeit muss national und international auf allen politischen Ebenen herbeigeführt werden. Dies erfordert die Festlegung von Prioritäten, die Überwindung von Umsetzungsdefiziten und das Schaffen von Vertrauen in die Fähigkeit des Staates, diesen Wandel zu bewältigen.
- Für die Konrad-Adenauer-Stiftung ist Nachhaltigkeit ein Kernanliegen. Wichtig ist uns dabei, dass ein ökologischer Wandel ökonomisch tragfähig ist und sich an den Lebensrealitäten der Menschen orientiert.
Inhalt
1. Nachhaltigkeit bedeutet, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen
2. Resilienz entsteht durch Bewahrung und Erneuerung
3. Nachhaltigkeit in der multipolaren Welt
4. Mit einem breiten Angebot zu mehr Nachhaltigkeit im In- und Ausland
5. Unsere Angebote und Projekte zum Thema
6. Publikationen, Veranstaltungen und Medienbeiträge zum Thema
Klimawandel, Kriege und Konflikte haben die geopolitisch zerklüftete Welt in eine Wirtschaftskrise mit schwindendem gesellschaftlichem Zusammenhalt manövriert. Diese zentralen Herausforderungen unserer Zeit werfen uns auf grundlegende Fragen zurück: worauf bauen wir unsere Zukunft? Wie müssen wir jetzt leben, damit das Leben auf der Erde auch für künftige Generationen noch lebenswert bleibt und sie es weiterhin in Ausübung ihrer Grundrechte gestalten können?
Nachhaltigkeit bedeutet, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen
Nachhaltigkeit wird verstanden als systemische Balance aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Entwicklung, die in einer komplexen Wechselwirkung stehen. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist in politischen Debatten, in Wissenschaft und Forschung wie auch in Forderungen der Zivilgesellschaft, auf nationaler und auf internationaler Ebene weiterhin präsent. Er polarisiert aber insbesondere mit Blick auf seine soziale Dimension auch hierzulande angesichts einer wachsenden tatsächlichen oder zumindest wahrgenommenen sozialen Ungleichheit. Diese Polarisierung ist auch auf eine oft moralisch überfrachtete, defizitorientierte Diskussion zurückzuführen. Wirtschaftliche Fragen um Wachstum, Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit – auch die Wettbewerbsfähigkeit der Idee eines nachhaltigen Wandels – rücken in den Vordergrund.
Dabei bleibt Nachhaltigkeit ein Querschnittsthema, für das es keine einfachen Lösungen gibt. Letztlich geht es um verantwortliches Gestalten unserer Zukunft.
Resilienz entsteht durch Bewahrung und Erneuerung
Zukunftsfähigkeit und -festigkeit sind auch Leitmotive im Wettbewerb der politischen Ideen auf den verschiedenen Ebenen – in Bund, Ländern und Kommunen, im europäischen Haus und im globalen Dorf. Welche Entscheidungen müssen heute getroffen werden, um Erreichtes zu bewahren, gewünschte Entwicklungen anzustoßen und um auf Widerstandsfähigkeit von Natur, Wirtschaft und Gesellschaft gegen Disruptionen hinzuwirken? Prioritäten müssen gesetzt und dabei auch Zielkonflikte bedacht werden. Zumeist mangelt es nicht an (wissenschaftlichen) Erkenntnissen, sondern es gilt Umsetzungsdefizite mit gesundem Pragmatismus zu überwinden und Vertrauen dafür zu schaffen, dass der demokratische Rechtsstaat den grundlegenden Wandel meistert.
Die erforderliche Dekarbonisierung und angestrebte Klimaneutralität von Wirtschaft und Gesellschaft bringen zweifellos Herausforderungen mit sich. Innovationen – seien es Technologien, Verfahren oder Verhaltensänderungen – können ein Schlüssel zu einem schonenderen Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen sein und zugleich der Anpassung von Lebens- und Geschäftsmodellen an die Auswirkungen des Klimawandels dienen.
Der Ausbau von Erneuerbaren Energien und der dazugehörigen Infrastruktur, die Förderung klimaneutraler Technologien, Diversifizierung von Rohstoff- und Energieimporten, Maßnahmen für höhere Energieeffizienz sowie geschlossene Produktkreisläufe und Recycling (zirkuläres Wirtschaften) sind als Anpassungsmaßnahmen von grundlegender Bedeutung. In der Landwirtschaft muss die Produktion von Nahrungsmitteln mit Arten- und Klimaschutz zusammengedacht werden. Mobilität muss in vielerlei Hinsicht neu gedacht werden, wobei die Belange der Städte und ländlichen Räume gleichermaßen berücksichtigt und durch innovative und nachhaltige Ansätze miteinander verbunden werden müssen.
Luftverschmutzung und Klimawandel gehören laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu den größten Gefahren für die Gesundheit weltweit. Ein zunehmend hohes Risiko stellen ebenfalls Zusammenhänge zwischen der menschlichen Gesundheit und der von Tieren und der Umwelt dar: Zoonosen, also zwischen Tier und Mensch übertragbare Krankheitserreger sind potenzielle Quelle für künftige Pandemien. Überverabreichung von Antibiotika an Nutztiere steigert die Zahl antimikrobieller Resistenzen. All dies wird im „One Health“-Ansatz erfasst, der solche Wechselwirkungen zwischen Mensch, Tier und der natürlichen Umgebung berücksichtigt und bei der Stärkung von Gesundheitssystemen sowie bei der Pandemieprävention betont.
Nachhaltigkeit in der multipolaren Welt
Die geopolitische Fragmentierung, für die Russlands Krieg gegen die Ukraine ein besonders gravierender Ausdruck ist, vergrößert die Aufgaben, verstärkt die Zielkonflikte und wirft eine Reihe von Fragen auf: wie ist die Energieversorgungssicherheit zu gewährleisten, für die man derzeit mangels ausreichender Verfügbarkeit und Steuerbarkeit erneuerbarer Energien noch teilweise von fossilen Energieträgern abhängig ist? Welche Rolle sollte die EU mit ihrem Clean Industrial Deal hier spielen? Wie kann eine dauerhafte Verfehlung der Klimaschutzziele verhindert werden, zumal sich die Auswirkungen der Erderwärmung weltweit in aller Dringlichkeit manifestieren? Wie lässt sich der globale Rohstoff- und Energiehunger für den Einsatz neuer Technologien sozial- und umweltgerecht stillen? Wie können Entwicklungsländer bei einem klimafreundlichen Auf- und Umbau ihrer Wirtschaft in der kriselnden Welt unterstützt werden? Und nicht zuletzt: erkennen die Industrieländer, dass Klimafragen nicht nur eine ethische, sondern auch eine wirtschaftliche und eine sicherheitspolitische Dimension haben?
Mit einem breiten Angebot zu mehr Nachhaltigkeit im In- und Ausland
Diese Fragen sind auch für die Konrad-Adenauer-Stiftung bei ihrer Arbeit im In- und Ausland von zentraler Bedeutung. Mit Veranstaltungen, Studien und Analysen begleiten wir die politische und gesellschaftliche Diskussion zu den aktuellen Fragestellungen und bieten Plattformen für den interdisziplinären Erfahrungsaustausch in Deutschland, Europa und in den Partnerländern weltweit.
Nachhaltigkeit ist für uns dabei nicht nur eine ordnungspolitische Herausforderung, sondern auch ein Kernanliegen zur Bewahrung der Schöpfung und zur Wahrung der Menschenrechte weltweit. Nach unserem Verständnis ist nachhaltige Entwicklung Wohlstandsvoraussetzung und ein Prinzip der sozialen Marktwirtschaft.
Uns ist wichtig, dass der Wandel zu mehr Nachhaltigkeit ökonomisch tragfähig ist und sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen orientiert, damit sie bei ihnen Akzeptanz findet und der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht erodiert. Neben der ökologischen, der ökonomischen und der sozialen Dimension hat Nachhaltigkeit auch eine politische Komponente. Denn Nachhaltigkeit lebt von der aktiven Partizipation der Bürgerinnen und Bürger, die die Zukunftsfähigkeit des Landes mitgestalten sollen. Demokratien sind daher besonders prädestiniert, die tiefgreifenden Veränderungen entlang ihrer Wertestruktur, aber auch mit dem erforderlichen Pragmatismus voranzutreiben. Neben der gesellschaftlichen Akzeptanz ist der politische Wille zur Umsetzung von Nachhaltigkeit entscheidend, um die notwendigen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.
Politischen Entscheidungsträgern im In- und Ausland möchten wir daher Anregungen für die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen rund um Umwelt, Ressourcen und weitere Nachhaltigkeitsfragen geben. Daher setzen wir uns auch ein für Allianzen zwischen Staaten, die hohe Nachhaltigkeitsstandards anstreben und diese mit ihren Bürgern gestalten.
Unsere Angebote und Projekte zum Thema
Publikationsreihen und Publikationsprojekte
Die Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Lebensweise ist eines der wichtigsten Ziele für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Wie kann es gelingen, ein Gleichgewicht zwischen der menschlichen Art zu leben und dem globalen Ökosystem Erde herzustellen, ohne flächendeckend auf alles verzichten zu müssen? Unsere Publikationsprojekte liefern hierzu Denkanstöße und gewähren Einblicke in Innovationen, die bei diesem Entwicklungsprozess helfen können.
Monitor Nachhaltigkeit
Mit der Reihe Monitor Nachhaltigkeit greifen wir aktuelle Nachhaltigkeitsthemen zumeist anlassbezogen aus Perspektive der Konrad-Adenauer-Stiftung auf, um sie einer interessierten Öffentlichkeit in Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zugänglich zu machen und einen Beitrag zur Positionierung der Stiftung zu diesem wichtigen Querschnitts- und Zukunftsthema zu leisten.
Kooperation
Um eine markt- und innovationsorientierte Strategie für Klimaneutralität zu fördern, hat die Konrad-Adenauer-Stiftung eine Kooperation mit EPICO Klimainnovation – Denkfabrik und Netzwerk für nachhaltige, marktbasierte und innovationsorientierte Klima- und Energiepolitik – geschlossen.
Kooperation mit EPICO Klimainnovation
Seit dem Jahr 2021 pflegt die Konrad-Adenauer-Stiftung eine Kooperation mit EPICO KlimaInnovation. Die Denkfabrik hat es sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige, markt- und innovationsorientierte Strategien für Klimaneutralität aus der gesellschaftlichen Mitte heraus zu entwickeln und zu deren Umsetzung beizutragen. Herzstück der Kooperation zwischen der KAS und EPICO ist der „Policy Accelerator for Climate Innovation“.
In diesem Projekt wurden im Rahmen eines agilen Design-Thinking-Prozesses klare Handlungsempfehlungen zu Schlüsselthemen der Energiepolitik und Zielbildern zur Erreichung von Klimaneutralität erarbeitet, die auch in Zukunft begleitet und über ein starkes Netzwerk in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft in der Umsetzung vorangetrieben werden sollen.