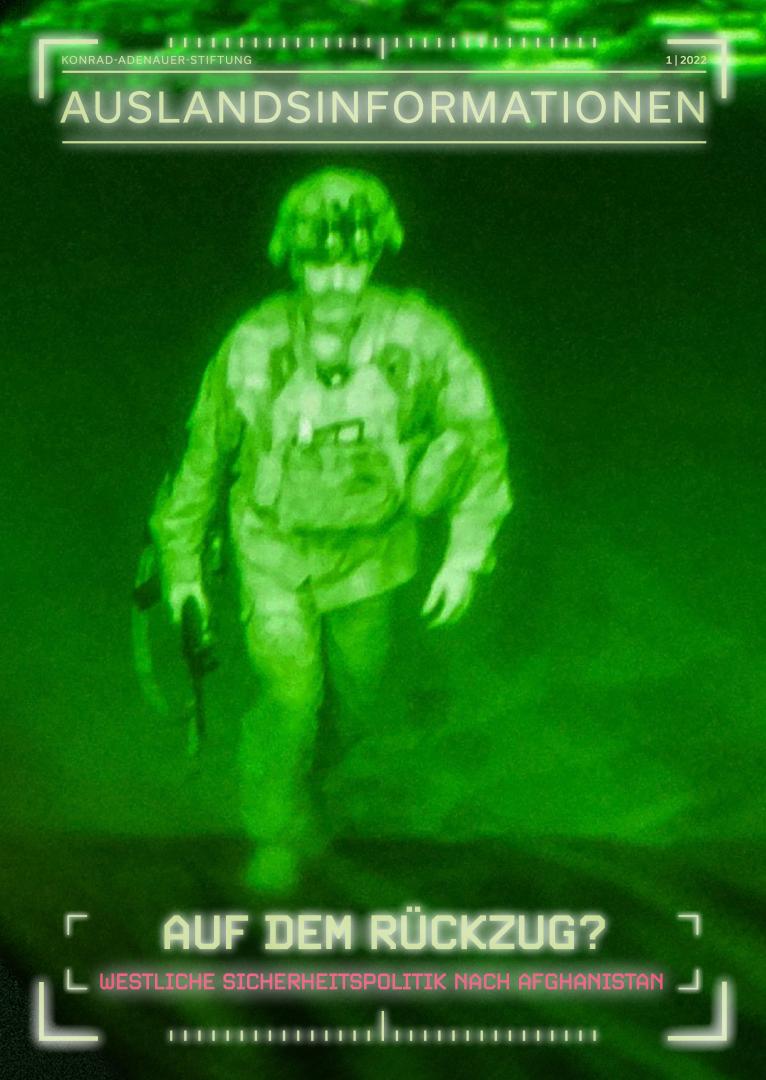Der Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan im Sommer 2021 war weit mehr als das katastrophale Ende einer Mission. Die Ereignisse werfen vielmehr grundlegende Fragen auf zum außenpolitischen Selbstverständnis und zur künftigen strategischen Ausrichtung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das betrifft auch die Debatte über Für und Wider von Auslandseinsätzen und internationalen Interventionen.
Inhaltsverzeichnis anzeigenÜber diese Reihe
Die Auslandsinformationen (Ai) sind die Zeitschrift der Konrad-Adenauer-Stiftung für Internationale Politik. Sie bieten politische Analysen unserer Expertinnen und Experten in Berlin und aus mehr als 100 Auslandsbüros in allen Weltregionen. Gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
Bestellinformationen
Unsere Zeitschrift für internationale Politik erscheint viermal im Jahr. Wir liefern Ihnen Hintergründe zum Weltgeschehen – und das kostenlos. Egal ob Sie unser Politikmagazin digital lesen oder das Printprodukt in deutscher oder englischer Fassung beziehen wollen: Nutzen Sie unser Anmeldeformular und mit wenigen Klicks sind Sie am Ziel.
Herausgeber
Dr. Gerhard Wahlers
ISBN
0177-7521
Benjamin Gaul
 benjamin.gaul@kas.de
+49 30 26996 3584
benjamin.gaul@kas.de
+49 30 26996 3584

Leiter der Abteilung Auslandsinformationen und Kommunikation