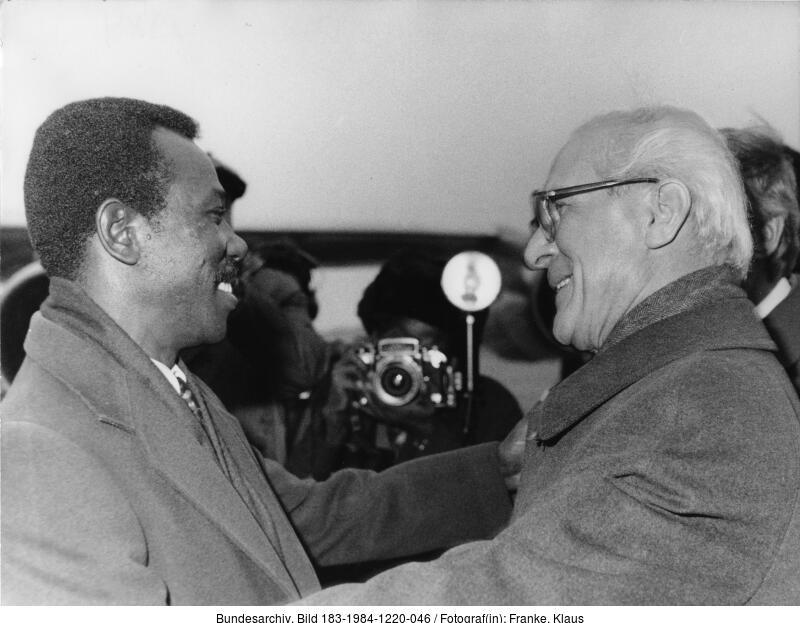Seit dem Amtsantritt Donald J. Trumps zum Präsidenten der Vereinigten Staaten Anfang 2025 steht die westliche Staatengemeinschaft unter enormem Druck. Vor allem die vielbeachtete Abrechnung mit Europa, die Vizepräsident JD Vance Mitte Februar auf der Münchener Sicherheitskonferenz vortrug, deuteten Beobachter als Wegmarke der Erosion des Westens. Unter Beschuss ist der Westen als Werte-, Organisations- und Interessensgemeinschaft aber schon deutlich länger. Seit dem Ende des Ost-West-Konflikts häufen sich Gegensätze, Konflikte, Reformrufe und Abgesänge. Eher unbemerkt bleibt in diesem Dauerfeuer auf EU und NATO der ideelle Angriff in Gestalt akademischer und intellektueller Gerechtigkeitsdebatten. Vor allem die unter dem Begriff „postkoloniale Theorien“ firmierenden Ideen und Konzepte beschäftigen sich immer weniger mit der Aufarbeitung des historischen Kolonialismus und immer öfter mit der Dämonisierung und Dekonstruktion von im europäisch-atlantischen Raum entstandenen Geschichts- und Werteverständnissen.
Interessiert an Neuerscheinungen zu historischen Ereignissen und Entwicklungen, die auf unserem Public-History-Portal GESCHICHTSBEWUSST erscheinen? Hier können Sie sich für unseren E-Mail-Verteiler anmelden.
Wandel in der Wahrnehmung von Welt
Seit den 1990er Jahren haben sich auch an deutschen Universitäten Theorien und Aktivismen etabliert, die einen Perspektivwandel in der bislang verbreiteten Wahrnehmung von Welt und Geschichte vorantreiben. Mit den Schriften von Frantz Fanon, Michel Foucault, Edward Said und Judith Butler in der Hand wird vor allem in den Sozialwissenschaften die Dekonstruktion vorgeblicher Machtdiskurse betrieben. Verdienste dieses sprachlichen Perspektivwandels sind ohne Zweifel gegeben: Romantische Verklärungen der Kolonialzeit sind kaum noch salonfähig. Und auch, dass koloniale Verbrechen in Form von Landesgrenzen, Abhängigkeitsverhältnissen und nicht zuletzt in den Köpfen nachwirken, ist zum Glück unbestritten.[1]
Dennoch regt sich immer mehr Kritik an der postkolonialen Theoriefamilie. Der Soziologe Vivek Chibber diagnostiziert dem Postkolonialismus ein klischeehaftes Bild anderer Weltregionen.[2] Andere werfen ihm Unwissenschaftlichkeit, Geschichtsrevisionismus, mangelnde Kritikfähigkeit und Schwarz-Weiß-Denken vor. Nicht erst seit dem Terrorangriff des 7. Oktober 2023 stehen vor allem Vorwürfe der Holocaustrelativierung und des Antisemitismus im Raum.[3] Aber auch die postkoloniale Gegenwehr nimmt zu. Hier sieht man Geschichtsrevisionismus am Werk, diagnostiziert uninformiertes Raunen oder wittert eine autoritär-illiberale Kampagne.[4] Es wird also scharf geschossen in der Postkolonialismusdebatte.
Europa als das Übel der Welt
Eigentümlicherweise spielt in dieser Debatte die zentrale Grundannahme postkolonialer Theorien nur eine nachgeordnete Rolle – die Abwertung des Westens. Gerade jüngere Strömungen interessieren sich kaum noch für Geschichte und Nachwirkungen kolonialer Zustände, sondern dehnen die Diagnose und Beschreibung des Fortbestands dieser Zustände immer weiter aus. Spätestens hier wird es problematisch. Nicht dem Kolonialismus als globales und überzeitliches Phänomen gilt das Erkenntnisinteresse, sondern ausschließlich dem europäischen Kolonialismus der vergangenen Jahrhunderte – und seinen vermeintlichen neo- und postkolonialen Manifestationen in der Gegenwart. Osmanische Eroberungen, arabischer Sklavenhandel, sowjetischer Imperialismus, iranischer Revolutionsexport und vieles andere werden ausgeblendet oder relativiert.[5]
Zentraler Ausgangspunkt dieser Wandlung vom produktiven Ansatz zum antiwestlichen Wissensregime ist die 1978 von Edward Said in seinem postkolonialen Standardwerk Orientalism formulierte Hypothese, dass der Westen den Orient als negative Schablone zur Selbstdefinition brauche. Said lieferte damit das passende Buch in einer Zeit, in der vielen Linken der real existierende Sozialismus zunehmend peinlich wurde und in der die Revolution im Iran manche falsche Hoffnung weckte. Westliche „Kolonialität“ und die Vorstellung, dass westliche Gesellschaften intrinsisch und letztendlich unüberwindbar rassistisch seien, ersetzte immer öfter den Kapitalismus als Erklärung für die Übel dieser Welt.
Beschleunigt wurde diese Entwicklung vom Ende des Ost-West-Konflikts und den Terrorangriffen des 11. September. Die offene oder klammheimliche Zustimmung zum Angriff auf die USA aufseiten mancher westlicher Intellektueller förderte das Bewusstsein für ein Phänomen, das die Postkolonialismus-Kritiker Ian Buruma und Avishai Margalit Anti-Westernism nannten.[6] Dieser Anti-Westernismus fand nach der Jahrtausendwende weiter Nahrung. Das Scheitern westlicher Bemühungen um Demokratieexport und die Zunahme weltweiter Krisen stützten die postkoloniale Annahme, dass der Westen der Welt eher schade als nutze.
Die Idee vom Indigenen
Die Abwertung des Westens fand ihre Entsprechung in der Aufwertung des Südens. Der Journalist Jens Balzer erklärt diesen Trend mit der Idee vom „Indigenen“ als Leitmotiv postkolonialen Denkens. Auf einmal seien Volk, Nation, Herkunft und Tradition wieder hochgeschätzte Werte – solange sie von als nicht-westlich eingeordneten Personen vertreten werden.[7] Zur Heimat dieser nicht-westlichen Personen wurde der sogenannte „globale Süden“ erkoren. Auch dieser schillernde Begriff ist seit Langem in der Diskussion, ohne dass bislang geklärt wäre, wer genau dazugehört und was damit gemeint ist. Der „globale Süden“ reduziert sich so zum Kampfbegriff, der für alles Mögliche in Stellung gebracht werden kann. Für den Politologen Wolfgang Kraushaar dient er primär der Diskreditierung des Westens und „hilft nicht weiter, wenn man die Folgen des Kolonialismus verstehen will.“[8]
Theorien für Diktatoren
Konjunktur hat der „globale Süden“ auch deshalb, weil die antiwestliche Selbstkritik westlicher Denker ein wichtiger Verbündeter für die machtpolitischen Gegner des Westens ist. Bereits im Februar 2017 forderte der russische Außenminister Sergei Lawrow auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine „post-westliche Weltordnung“ und sucht seither den Schulterschluss mit Gleichgesinnten. Der ultranationalistische russische Philosoph Aleksandr Dugin bemüht das Bild der Dekolonialisierung ebenso wie Hindunationalisten, chinesische Machtpolitiker und iranische Mullahs. Überall auf dem Globus wird der Topos westlicher Kolonialität und Ausbeutung aktiviert, um autoritäre, reaktionäre und ethnonationalistische Politiken zu legitimieren.
Als erste verstanden hatten dies die Islamisten. Seit rund hundert Jahren propagieren sie den Islam (und nicht den Westen) als Lösung aller Probleme. Der Kampf gegen Demokratie, Menschenrechte und Säkularismus, aber auch gegen Frauen, ethnische Minderheiten, Homosexuelle und Andersgläubige wird hier als indigene „muslimische Perspektive“ verbrämt. Wie die realpolitische Umsetzung einer solchen Perspektive aussehen kann, lässt sich im Iran, in Afghanistan und in Gaza beobachten. Vor allem für die Islamisten der Hamas und für andere Feinde des Staates Israel sind postkoloniale Diskurse und die in diesen verwendeten Diffamierungsvokabeln (Genozid, Apartheid und Kolonialstaat) hochwillkommen. Noch am Tag des Massakers vom 7. Oktober feierte die Boykottbewegung BDS den Angriff als Reaktion der „indigenen Palästinenser“ auf ethnische Säuberungen von „Apartheid Israel und des kolonialistischen Westens“.[9]
Unfähigkeit zur Selbstkritik
Es ist zu diskutieren, ob der Postkolonialismus generell antisemitisch ist oder ob der in seinen Reihen zum Ausdruck kommende Antisemitismus lediglich Ausdruck und Folge eines antiwestlichen Weltbildes sind. Für den Publizisten Yascha Mounk lässt sich das kaum noch trennen. In den intersektionalen Diskursen der Postkolonialisten würden Israel und damit die israelischen Juden dem abzulehnenden Westen zugeschlagen und seien deshalb ebenfalls abzulehnen.[10] Vertreter postkolonialer Theorien werden damit oft genug zu den nützlichen Idioten jener, die Menschenrechte, Demokratie, Freiheit oder Israel abschaffen wollen. Es bleibt ein Rätsel, warum sich große Teile der postkolonialen Forschung dem selbstkritischen Diskurs hierüber immer noch verweigern.
Selbstkritische Reflexion verdient auch die Tatsache, dass postkoloniales Denken die Grundlagen einer regelbasierten internationalen Ordnung in Frage stellt. Wenn im Anschluss an Michel Foucault Aussagen über die Welt als machtpolitische Sprecherpositionen begriffen werden, gibt es keine objektiven Wahrheiten mehr – auch keine postkolonialen. Globale Ordnungs- und Regelungssysteme, internationale Organisationen und Regime und letztendlich das Völkerrecht werden so (zumindest in ihren derzeitigen Ausprägungen) zu Konstruktionen einer kolonialen, westlichen Unterdrückungsordnung. Die diesen Systemen zugrundeliegenden menschen- und völkerrechtlichen Prinzipien werden nicht länger als universal gültig, sondern als zeit- und kontextspezifische „eurozentrische“ Perspektiven angesehen.[11] Die realpolitischen Folgen dieses Perspektivwechsels sind überall sichtbar. Globale Institutionen und Regelwerke werden unterlaufen, diskreditiert und konterkariert.
Südverbindungen statt „Globaler Süden“
Wie aber lassen sich westliche und universale Werte in Zeiten zunehmender globaler Unübersichtlichkeiten bewahren? Der vieldiskutierte schottische Historiker Niall Ferguson plädiert für eine Neuerfindung und Selbstvergewisserung des Westens.[12] Wer es eine Nummer kleiner will, sollte bei seinen Institutionen anfangen. Allen voran EU und NATO sind angesichts erheblicher innen- und außenpolitischer Herausforderungen und Bedrohungen heute unverzichtbarer denn je. Die wichtigste Antwort auf die zunehmende Westkritik wäre deshalb die Stärkung der Westbindung im Sinne einer institutionellen Weiterentwicklung und Stärkung westlicher Bündnisse und Kooperationsstrukturen – trotz, mit und gerade wegen Trump.
Zudem spricht vieles heute für eine Ergänzung der Westbindung durch eine Intensivierung von Südverbindungen: Grundidee hierbei wäre nicht eine postkoloniale Umdeutung der Geschichte, sondern die Stärkung kooperativer Elemente und konkreter Problemlösungen. Postkoloniale Theorien werden entgegen ihrer Eigenwahrnehmung weder die Konflikte im Nahen Osten oder in der Ukraine lösen noch für globalen Wohlstand sorgen, Frauen gleichberechtigen oder den Klimawandel bewältigen. Hierzu braucht es Allianzen, Bündnisse und Diplomatie.
Der Regierungswechsel in Deutschland bietet die Chance, die Stärkung solcher Südverbindungen voranzutreiben. Einiges an ideologischen, sprachlichen und konzeptionellen Altlasten wäre davor abzuräumen. Die bisherige Bundesregierung hat sich außenpolitisch nicht nur mit moralisierender Besserwisserei, sondern auch allzu oft mit einer unbekümmerten Übernahme postkolonialer Annahmen und Begriffsumdeutungen hervorgetan. Das kam in manchen Milieus zuhause im Westen gut an. Bei den weltweiten Partnern deutscher und europäischer Politik stießen Konditionierungen, Belehrungen und selbstreferenzielle Theorien bestenfalls auf Unverständnis. Hier fordert man Handel, Investitionen, interessenbasierte Partnerschaften und klare Regelwerke. Abstrakte westliche Debatten über die Überwindung struktureller Machtungleichgewichte werden hier nicht gebraucht. Was hier auch nicht gebraucht wird, sind Autokraten und Diktatoren, denen genau solche Debatten in die Hände spielen.
Dr. Andreas Jacobs ist stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Analyse und Beratung sowie Leiter der Abteilung Gesellschaftlicher Zusammenhalt der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Verweise
[1] Vgl. hierzu Albrecht, Monika: Erinnerungspolitische Transformationen und koloniale Gewalt. Aus der Perspektive der Critical Post-Colonial Studies, in: Dunker, Axel/Hofmann, Michael/Yowa, Serge (Hrsg.): Postkoloniale Germanistik und Konflikte im globalen Kontext. Möglichkeiten und Ausblicke im 21. Jahrhundert, Berlin/Boston 2023, S. 130-163.
[2] Vgl. Chibber, Vivek: Postcolonial Theory and the Specter of Capital, London 2013.
[3] Vgl. hierzu Elbe, Ingo: Antisemitismus und postkoloniale Theorie. Der „progressive“ Angriff auf Israel, Judentum und Holocausterinnerung, Berlin 2024.
[4] Für aktuellere Kritiken an der Postkolonialismus-Kritik vgl. Conrad, Sebastian, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14.02.2024, S. N3 sowie Ouma, Stefan, Revanchistischer Kulturkampf, in; taz vom 06.04.2014.
[5] Vgl. Albrecht 2023, S. 134.
[6] Vgl. Buruma, Ian/Margalit, Avishai: Okzidentalismus. Der Westen in den Augen seiner Feinde, München 2005.
[7] Vgl. Balzer, Jen: Rettet den Postkolonialismus. Warum es höchste Zeit ist, die linke Denkschule vor ihren eigenen Irrtümern zu schützen, in: DIE ZEIT vom 08.05.2024, S. 46
[8] “Latent antisemitische Denkmuster”, Interview mit Wolfgang Kraushaar, Süddeutsche Zeitung vom 16.11.2023, S. 9.
[9] „Westliche Mitschuld an Apartheid Israels brutaler Gewalt stärkt palästinensischen Widerstand und internationale Solidarität“, zit. nach Westliche Mitschuld an Apartheid Israels brutaler Gewalt stärkt palästinensischen Widerstand und internationale Solidarität | BDS-Kampagne (abgerufen am 15.09.2024).
[10] „Zu welcher Gruppe gehörst du?“ Interview mit Yascha Mounk in: WELT AM SONNTAG vom 28.01.2024, S. 39.
[11] Exemplarisch für eine solche Perspektive vgl. Chakrabarty, Dipesh: Provincializing Europe, Princeton 2000 sowie Spivak, Gayarti Chakravorty: A critique of postcolonial reason, Cambridge 1999.
[12] Vgl. Fergusson, Niall: Der Westen und der Rest der Welt. Die Geschichte vom Wettstreit der Kulturen, Berlin 2011.