Ausgabe: 2/2025
Liebe Leserinnen und Leser,
als die Vereinten Nationen 1945 gegründet wurden, hatten sie 51 Mitgliedstaaten, heute sind es 193. Zwei Zeiträume waren es, in denen der Anstieg besonders markant war: einmal um 1990 – der Zerfall der Sowjetunion – und zuvor zwischen Mitte der 1950er- und Anfang der 1960er-Jahre durch die weitgehende Auflösung der verbliebenen europäischen Kolonialreiche und die „Entlassung“ der entsprechenden Gebiete in die staatliche Unabhängigkeit.
Mehr als ein halbes Jahrhundert ist das nun her, einen Schlussstrich unter das Thema Kolonialismus bedeutete es aber keineswegs. Das ist auch gut so. Die Heraus- und Aufarbeitung von Verbrechen, die vorwiegend westeuropäische Kolonialmächte in den von ihnen abhängigen Weltregionen begangen haben, ist ein berechtigtes Anliegen. Ebenso berechtigt ist die Frage, ob und inwieweit wirtschaftliche Ausbeutung und in der Kolonialzeit geschaffene Strukturen die Entwicklung ehemaliger Kolonien auch nach der Unabhängigkeit belastet haben. Das ist auch keine neue Frage. Einige Leserinnen und Leser werden sich an die marxistisch beeinflusste Dependenztheorie erinnern, die sich in den 1960er- und 1970er-Jahren als Reaktion auf die Modernisierungstheorie gerade mit dem Thema der Unterentwicklung als Ergebnis einer vermeintlich strukturellen Abhängigkeit von globalen, westlich dominierten kapitalistischen Systemen auseinandersetzte.
Es hat sich in den vergangenen Jahrzehnten unter dem Oberbegriff Postkolonialismus im akademischen und politisch-aktivistischen Raum auch ein Diskurs herausgebildet, der über diese Fragen und Anliegen weit hinausgeht. In Deutschland ist das lange von einer breiteren Öffentlichkeit unbeachtet geblieben. Dann kam der 7. Oktober 2023: Eine islamistische Terrororganisation überfällt Israel, die einzige liberale Demokratie des Nahen Ostens, ermordet wahllos Zivilisten und nimmt weitere als Geisel. Die zynische Stellungnahme mancher selbsternannter „Progressiver“: legitimer Befreiungskampf indigener Palästinenser gegen einen Staat weißer Siedlerkolonialisten.
Dieses krasse politische und moralische Fehlurteil ist die auffälligste Blüte, die die Schwächen dieser postkolonialen Theorien zuletzt getrieben haben. Diese Defizite und ihre Folgen haben die Kolleginnen und Kollegen von den Wissenschaftlichen Diensten der Konrad-Adenauer-Stiftung zuletzt in einem Sammelband und auf dem Portal „Geschichtsbewusst“ umfangreich analysiert, entsprechende Informationen finden Sie weiter hinten in diesem Heft.
Andreas Jacobs stellt diese Kritikpunkte in dieser Ausgabe der Auslandsinformationen ebenfalls prägnant heraus: Unwissenschaftlichkeit, West-Feindlichkeit, Antisemitismus, Anfälligkeit für Missbrauch durch Autokraten und fast völlige Nutzlosigkeit für die Menschen in den früheren Kolonien, deren Anwalt die Verfechter postkolonialer Diskurse doch zu sein vorgeben. „Methodisch und empirisch fundierte Arbeiten“, so der Autor, „sind in diesem Genre eher die Ausnahme als die Regel“. Mit diesem Heft wollen wir vor allem durch die Perspektiven unserer Auslandsbüros einen fundierten, wenngleich nicht erschöpfenden Beitrag zur Auseinandersetzung mit der Frage leisten, welche Rolle koloniales Erbe und das Sprechen darüber in verschiedenen Ländern und Weltregionen tatsächlich spielen.
Anja Berretta nimmt sich in ihrem Artikel zu den Handelsbeziehungen afrikanischer Staaten die Frage vor, ob die – in vielen Fällen schlechte – wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder durch die Folgen europäischer Kolonialherrschaft und fortbestehende unfaire Handelsbeziehungen zwischen dem Westen und Afrika zu erklären ist. Anhand einer Vielzahl von Daten und Länderbeispielen kann sie zeigen, dass tatsächlich die von den jeweiligen afrikanischen Regierungen gewählte Handels- und Wirtschaftspolitik eine viel plausiblere Erklärung für die Performance der jeweiligen Länder bietet.
Auf eine ganz eigene Art ist das Thema Kolonialismus für manche autoritären Staaten relevant. David Merkle analysiert in seinem Beitrag, wie China und Russland bestimmte historische Narrative nutzen, um einerseits die Herrschaft der jeweils Regierenden im eigenen Land zu festigen und andererseits auf der internationalen Bühne die westlichen Staaten zu diskreditieren. Ein beliebtes Werkzeug bei Letzterem sind postkoloniale Diskurse, die mithilfe Künstlicher Intelligenz und sozialer Medien nicht nur in Afrika, Asien und Lateinamerika, sondern auch an ein geneigtes Publikum in den westlichen Gesellschaften ausgespielt werden.
Dass nicht zuletzt Moskau oft erfolgreich bei dem Versuch ist, Europa und die USA als Kolonialisten, sich selbst dagegen als antiimperialistische Macht ohne koloniale Vergangenheit zu porträtieren, ist bemerkenswert, da es in seiner Nachbarschaft eine mit imperialen Ambitionen prall gefüllte Geschichte hat. Diese Geschichte zeichnen Stephan Malerius und Florian Binder am Beispiel des Südkaukasus nach und stellen heraus, dass Russland insbesondere in Teilen der georgischen Gesellschaft heute durchaus als Kolonialmacht gesehen wird.
Die autoritäre Linke Lateinamerikas dagegen, so zeigt es Sebastian Grundberger in seinem Beitrag, nutzt postkoloniale Diskurse nicht nur, um die Diktaturen von Havanna über Managua bis Caracas zu legitimieren, sondern auch, um ihre Allianz mit den Regierungen in Peking, Moskau und Teheran intellektuell zu unterfüttern – „gemeinsam gegen den Westen“, wie es in der Überschrift des Artikels heißt.
„Zwischen West und Süd“ verortet dagegen Philipp Gerhard die brasilianische Außenpolitik. Dass das größte Land Lateinamerikas sich in den vergangenen Jahrzehnten nach einer langen Geschichte der Westorientierung auch anderen Partnern zugewandt hat, führt der Autor auf mehrere Faktoren zurück. Der Einfluss postkolonialer Diskurse ist einer davon. Waren sie zunächst ein aus nordamerikanischen und europäischen Universitäten importiertes akademisches Elitenphänomen, haben diese Diskurse später in den linken brasilianischen Parteien Fuß gefasst und können heute zwar nicht den grundsätzlichen außenpolitischen Kurs des Landes, wohl aber manchen Ausschlag wie die antiisraelische Rhetorik von Präsident „Lula“ da Silva erklären.
Schließlich widmen sich zwei Beiträge der Frage des Umgangs westeuropäischer Staaten mit ihrem kolonialen Erbe. Erst vor wenigen Monaten handelte das Vereinigte Königreich die Übergabe der mitten im Indischen Ozean gelegenen und strategisch bedeutsamen Chagos-Inseln an Mauritius aus. Insgesamt, so Canan Atilgan und Lukas Wick in ihrem Artikel, fordern Staaten, die früher Teil des britischen Kolonialreichs waren und heute Teil des Commonwealth sind, von London verstärkt eine ehrliche Auseinandersetzung auch mit den dunklen Seiten des Empire. Zu dieser sei die britische Regierung grundsätzlich auch bereit, lehne Entschuldigungen oder Reparationen aber bislang ab.
Zwischen Deutschland und Tansania – bis zum Ersten Weltkrieg Teil der Kolonie Deutsch-Ostafrika – ist eine solche Diskussion in den vergangenen Jahren ebenfalls in Gang gekommen. Ausgangspunkt war aber weniger Daressalam als Berlin. Tilmann Feltes und Sebastian Laschet konstatieren in ihrem Beitrag, „dass es in Tansania vermutlich keine fehlgeleitete Kolonialismusdebatte ohne deutsches Zutun gegeben hätte“. Fehlgeleitet war die Debatte insofern, dass die vergangene Bundesregierung, insbesondere die Leitung des Auswärtigen Amts, sie einseitig zulasten von Themen, die die Regierung von Tansania ansprechen wollte, und teilweise ohne ausreichendes Wissen um die Erinnerungskultur in Tansania selbst führte und damit im Verhältnis zu dem Land mehr Schaden als Nutzen erzeugte.
Was folgt aus alldem für die deutsche und europäische Außenpolitik? Die Konsequenz aus missglückten Versuchen der Vergangenheitsbewältigung und berechtigter Kritik an postkolonialen Diskursen darf nicht darin bestehen, sich der Auseinandersetzung um die dunklen und teils verbrecherischen Seiten der europäischen Kolonialgeschichte zu entziehen. Wo diese Auseinandersetzung von unseren weltweiten Partnern gewünscht wird, sollten wir sie auch auf der Grundlage historischer Fakten führen. Das ist eine Frage der Moral, aber auch unserer Interessen. Viele der oben erwähnten heute 193 UN-Mitglieder sind ehemalige Kolonien. In unserem Konflikt mit revisionistischen Autokratien wie China und Russland spielt ihre Positionierung eine wichtige Rolle.
Was wir dagegen vermeiden sollten, ist eine ideologiegetriebene Vergangenheitspolitik, die mehr den seelischen Bedürfnissen heimischer Politiker und der Befriedigung der eigenen Wählerschaft sowie einschlägiger Aktivistengruppen dient als den Prioritäten unserer Partner. Und schon gar nicht sollten wir uns unkritisch einen postkolonialen Diskurs zu Eigen machen, der diese Partner komplett aus ihrer Eigenverantwortung entlässt, westlichen Kolonialismus zur Wurzel allen Übels auf der Welt erklärt und damit nicht nur in der Sache falsch liegt, sondern auch unseren Interessen massiv schadet.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Ihr
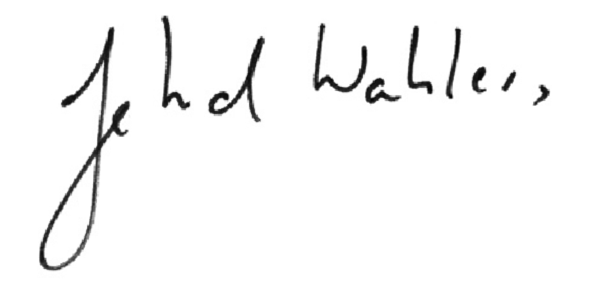
Dr. Gerhard Wahlers ist Herausgeber der Auslandsinformationen (Ai), stellvertretender Generalsekretär und Leiter der Hauptabteilung Europäische und Internationale Zusammenarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung (gerhard.wahlers@kas.de).






