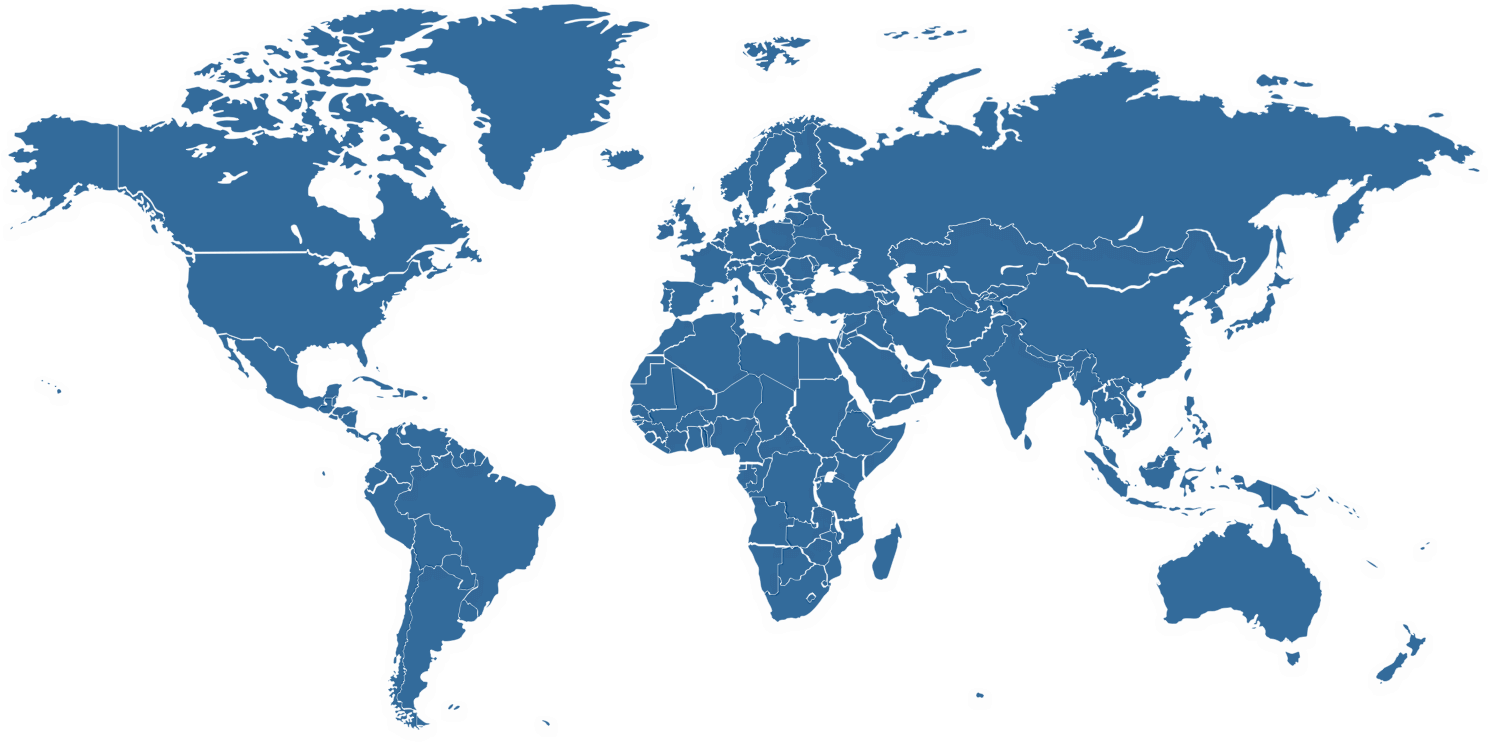Tosender Applaus erklingt im vollbesetzten Konferenzsaal des Ritz-Carlton Hotels in Riad, als US-Präsident Trump seine Rede beendet. Vor gerade einmal acht Jahren war das Hotel noch Schauplatz eines richtungsweisenden Machtkampfs um dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman geworden, im Zuge dessen hunderte Mitglieder der Königsfamilie und Wirtschaftselite wochenlang im Ritz inhaftiert wurden. Nun organisiert Saudi-Arabien hier ein amerikanisch-saudisches Investitionsforum zum Anlass der ersten umfänglichen Auslandsreise des US-Präsidenten. Hauptredner ist Trump selbst, Prinz Mohammed – inzwischen de facto Machthaber im Königreich – sitzt in vorderster Reihe und tauscht Nettigkeiten mit dem Präsidenten aus. Der Kronprinz legt die Hand aufs Herz. US-Präsident Trump strahlt zurück.
Es ist nicht bloß eine Männerfreundschaft, welche sich den Augen der Weltöffentlichkeit hier offenbart. Mit seiner ersten Auslandsreise zementiert Präsident Trump sein ohnehin enges Verhältnis zu den Golf-Staaten und grenzt sich vom widersprüchlichen Engagement seines Vorgängers Joe Biden ab, der Saudi-Arabien erst wegen der Tötung von Jamal Khashoggi öffentlich zum Aussätzigen erklärt hatte, nur um später doch nach Riad zu reisen, wo er saudische Mithilfe zur Senkung der Ölpreise sowie eine Annäherung an Israel erbat.
Trump hingegen versprach auf großer Bühne in Riad von vornherein, die USA „belehren nicht mehr, wie man zu leben habe“. In einer verblüffenden Rede gelobte der US-Präsident, gegenseitiger Respekt solle künftig den Austausch prägen und prognostizierte der Region ein goldenes Zeitalter – nicht durch westliche Intervention von außen, sondern von ihren Menschen selbst erschaffen. Trumps Botschaft verfängt in einer Region, welche die perzipierte moralische Überheblichkeit des Westens ebenso leid ist, wie dessen vermeintliche Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten.
KI ist Trendthema einer lukrativen Geschäftsreise
Trotz hochtrabender Ankündigung von einer neuen US-Außenpolitik am Golf zeigte Trumps Besuch auf der Arabischen Halbinsel vor allem eine bekannte Konstante: Amerikanisches Kernanliegen bleibt es, Investitionen der vermögenden Golf-Staaten einzutreiben. Schon im Vorfeld hatte Trump angekündigt, das Ziel sei, auf der Reise über eine Billion US-Dollar an Deals zu unterzeichnen. Dafür brachte er nicht nur Außenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth, Handelsminister Howard Lutnick und Finanzminister Scott Bescent mit an den Golf. Die mitgereiste Wirtschaftsdelegation umfasste auch Vertreter von vier der zehn wertvollsten US-Unternehmen und illustre Namen wie OpenAI-Chef Sam Altman, Larry Fink, den CEO von BlackRock, sowie FIFA-Präsident Gianni Infantino.
Bereits vor der Reise überschlugen sich Ankündigungen von Deals in den Bereichen Digitales, Rüstung und Infrastruktur. So waren saudi-arabische Investitionen in die USA von 600 Milliarden US-Dollar über vier Jahre kolportiert worden. Die VAE hatten ihrerseits nachgezogen mit der Ankündigung, über zehn Jahre 1,4 Billionen US-Dollar in den Vereinigten Staaten investieren zu wollen – fast das Dreifache des emiratischen Bruttoinlandsproduktes. In Katar, das sich anders als seine Nachbarn zunächst mit vollmundigen Versprechungen zurückgehalten hatte, wurden beim Präsidentenbesuch immerhin Wirtschaftsabkommen in Höhe von 240 Milliarden Dollar vereinbart.
Vor dem Hintergrund solcher Superlative stand vor allem ein Sektor im Rampenlicht: die Künstliche Intelligenz (KI). Einst ohne nennenswerten KI-Sektor, mausern sich die Golf-Staaten seit einigen Jahren zu weltweiten Knotenpunkten der Zukunftstechnologie. Unter Aufsicht von Trumps mitgereistem ‚Krypto-Zar‘ David Sacks vereinbarten die marktführenden US-Konzerne AMD und Nvidia, 18.000 KI-Supercomputer an eine Tochterfirma des saudischen Staatsfonds und jährlich 500.000 Hochleistungschips an den staatlichen emiratischen KI-Konzern zu liefern. Die VAE versprachen den USA sogar 10 Hektar Land und 5 Gigawatt Energie für den Aufbau des weltweit größten Datencampus im Land, mit dem die Emirate bis 2029 zum stärksten globalen Rechenzentrum aufsteigen könnten. Saudi-Arabien wiederum schloss mit US-Firmen eine Vereinbarung ab, Datenzentren für 10 Milliarden US-Dollar im Königreich zu errichten.
Den Golf-Staaten geht es um mehr als nur KI-Investitionen. Insbesondere wollen die Herrscher am Golf privilegierten Zugang zu amerikanischen Chips zugesichert bekommen, bei denen die meisten Länder strikten Exportbeschränkungen ausgesetzt sind. Im Zuge der Reise begannen Saudi-Arabien und die USA daher Gespräche über ein KI-Abkommen. Mit den VAE soll als erstem Land weltweit bereits ein Regierungsabkommen abgeschlossen worden sein – ohne dass auf der Reise Details dazu bekannt wurden. Während das Streben der Golf-Staaten nach Zugang zu US-Hochtechnologie verständlich ist, bleibt das Thema für die USA problematisch. Die enge wirtschaftliche Verflechtung des Golfs mit China sorgt nicht nur für Sicherheitsbedenken. Trumps Offenheit, KI an den Golf auszulagern, steht auch im eklatanten Widerspruch zu seiner Strategie in anderen Sektoren, wo er unter Inkaufnahme von Zollstreitigkeiten Industrien wieder in die USA zurückzwingen will.
Aller Pomp um die KI darf zudem nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Löwenanteil der vereinbarten Deals weiterhin im Verteidigungsbereich zu finden ist. Sowohl in den Katar als auch in Saudi-Arabien schlossen die USA im Zuge der Reise umfangreiche Verteidigungsabkommen ab – im Königreich als Teil einer umfassenden Wirtschaftspartnerschaft. Größter Einzelposten in Saudi-Arabien war ein Rüstungsabkommen über 142 Milliarden US-Dollar, der zweitgrößte Deal in Katar war das Versprechen des Emirats, 38 Milliarden in die amerikanische Militärbasis im Land zu investieren.
Unklare Details vermeintlicher Deals
Bei näherem Hinsehen bleiben viele Details der vermeintlichen Deals allerdings unklar. Während der Präsident die abgeschlossenen Abkommen in Saudi-Arabien auf 600 Milliarden US-Dollar bezifferte, errechnete die detaillierte Presseerklärung nach seinem Besuch 145 Deals in Höhe von nur der Hälfte: 300 Milliarden US-Dollar. Ungeachtet dessen versprachen der US-Präsident sowie der saudi-arabische Kronprinz aber, die bilateralen Deals würden im Nachgang sogar weiter auf eine Billionen US-Dollar anwachsen. Obwohl es Trump vor allem um die heimische US-Wirtschaft ging, umfassen die publizierten Absichtserklärungen zudem nicht nur Investitionen in die USA, sondern auch Finanzströme in die umgekehrte Richtung.
Das Kleingedruckte der Abkommen schien für Trump, der mehr an markigen Ankündigungen als an sorgfältiger Zahlenkunde interessiert war, ohnehin nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Obwohl Katar mit dem mitgereisten Boeing-Chef Kelly Ortberg einen Kaufvertrag von über 96 Milliarden US-Dollar für 210 Jets des US-Herstellers abschloss, behauptete Trump felsenfest, Katar würde Flugzeuge im Wert von 200 Milliarden kaufen. Das Weiße Haus folgerte zudem, das 240-Milliarden-Abkommen mit dem Emirat würde in Wirklichkeit einen „ökonomischen Austausch von 1,2 Billionen“ erzeugen – blieb eine nachvollziehbare Berechnung dieser kühnen Ankündigung aber schuldig.
Auch ist fraglich, ob manche der Absichtserklärungen tatsächlich so umgesetzt werden, wie vereinbart – und ob die schwindelerregenden Summen angesichts sinkender Ölpreise und knapper Staatskassen insbesondere in Saudi-Arabien überhaupt realistisch sind. Der Waffendeal zwischen Riad und Washington etwa umfasst das doppelte des saudi-arabischen Verteidigungsetats, die künftigen Investitionen von angeblich eine Billion US-Dollar wären äquivalent zur gesamten Wirtschaftsleistung des Königreichs. Allzu wörtlich sollte man die Zahlen daher nicht nehmen.
Schon bei Trumps erstem Besuch in Riad 2017 hatte dieser 450 Milliarden US-Dollar an saudi-arabischen Investitionen verkündet. Nachträgliche Berechnungen ziehen jedoch in Zweifel, ob das Geld in dieser Höhe wirklich jemals geflossen ist. Ohnehin waren viele der Deals nicht neu – etwa das emiratische Investitionspaket von 1,4 Billionen – sondern bereits lange vor Trumps Besuch vereinbart worden.
Die Kunst der Trump‘schen Beziehungspflege
Der Blick auf Investitionsankündigungen und Wirtschaftsabkommen allein greift aber zu kurz, wenn man die Bedeutung der Trump-Reise und deren Signalwirkung für die amerikanische Golf-Politik verstehen will. Bei den Deals geht es weniger darum, ob jeder angekündigte Dollar mit echtem Business hinterlegt ist, sondern um die politische Botschaft, die sie aussenden: Die Golf-Staaten sind für die USA nicht nur Geldautomat, sondern präferierter politischer Partner – und das trotz ihrer außenpolitischen Diversifizierung samt guter Beziehungen zu China wie Russland und der Betonung von zunehmender politischer Eigenständigkeit.
Die Art und Weise, wie nicht nur der Kronprinz Saudi-Arabiens, sondern auch Tamim bin Hamad, Emir von Katar, und der emiratische Präsident Mohammed bin Zayed persönliche Beziehungen, gar Freundschaften, zu Trump kultiviert haben, ist ein Lehrstück für andere Staaten, wie man effektiv mit dem eigenwilligen US-Präsidenten umgehen kann. Der Stil passt ohnehin gut zur Art und Weise, wie die hochgradig personalistischen Staatsysteme am Golf Politik betreiben. Dabei verwundert es auch nicht, dass die Golf-Staaten mit Milliardeninvestitionen in Trumps Umfeld, etwa einer Finanzspritze von zwei Milliarden US-Dollar für den Fonds seines Schwiegersohns Jared Kushner oder die Bauvorhaben für Trump-Wolkenkratzer und Golfclubs von Dschidda bis Dubai, die ohnehin schon schwammige Trennung zwischen Trumps offiziellen und privaten Interessen weiter verwischen.
Das Wohlwollen des US-Präsidenten ist den Golf-Monarchien damit sicher. Sein Besuch am Golf war nicht nur eine erfolgreiche Geschäftsreise für die Trump-Familie, die großzügigen Empfänge samt Eskorten mit Kampfjets, Kamelen und Araberpferden schmeicheln auch dem Ego des Präsidenten. Der schiere Reichtum der Golf-Staaten imponiert offensichtlich Trump in besonderem Maße, wie seine Ausführungen, dass Regierungsflieger am Golf größer und beeindruckender seien, als die eigene Air Force One und er daher beabsichtige, eine von Katar geschenkte Boeing 747 zu akzeptieren, verdeutlichen.
Golf-Staaten als zentrale Gestaltungsakteure
Dass die Scheichs offenkundig wissen, wie man mit Trump umgeht, manövriert die von ihnen regierten Länder in eine privilegierte Lage. Nicht nur können sie sich des Flankenschutzes aus Washington beim Thema Menschenrechte und politische Freiheiten sicher sein, sie vermögen es zudem ihre eigenen Interessen besser durchzusetzen und schaffen es einem oft eigensinnigen US-Präsidenten Konzessionen abzuringen. Bemerkenswert war etwa, dass Donald Trump, der die Abraham-Abkommen zwischen Israel und arabischen Nachbarn als Kernerfolg seiner ersten Amtszeit sieht und aus seiner Erwartung einer raschen israelischen Normalisierung mit Riad nie einen Hehl gemacht hatte, auf der Reise überraschend verkündete, Saudi-Arabien würde für diesen Schritt seine eigene Zeit brauchen – und er sei damit einverstanden. Für Riad ist die mögliche Anerkennung Israels angesichts der Kritik am Krieg im Gaza-Streifen momentan heikel. Dass die Golf-Monarchien ein solch enges Verhältnis zum amerikanischen Präsidenten kultiviert haben, verschafft ihnen offenkundig außenpolitische Handlungsspielräume, die andere Staaten vorenthalten bleiben.
Einmal mehr wird dabei klar, dass die Golf-Staaten zu den neuen Kraftzentren im Nahen Osten – und zunehmend auch auf der Weltbühne – aufgestiegen sind. Mit dem Ziel, ein stabiles Geschäftsumfeld für die Transformation der eigenen Wirtschaften für das postfossile Zeitalter zu schaffen, setzen sie sich vermehrt für Vermittlung und Deeskalation sowie die Stabilisierung ihrer Nachbarschaft ein. Dass sie Trumps Ohr haben, wird auch dafür strategisch genutzt. So konnte der Kronprinz dem Präsidenten die Aufhebung von Sanktionen gegen Syrien abringen und orchestrierte ein Treffen Trumps mit dem neuen syrischen Machthaber Ahmed Al Sharaa – das erste zwischen einem US-Präsidenten und syrischen Staatschef seit 25 Jahren – obwohl Al Sharaa bis dato auf der US-Terrorliste steht. Saudi-Arabien, Katar und andere Golf-Monarchien erhoffen sich nun eine positive Entwicklung Syriens und einen Stabilitätseffekt für die gemeinsame Nachbarschaft.
Trumps Reise verdeutlicht aber auch die Bedeutung des Golfs über die arabische Welt hinweg. Die USA werden sich gegenüber Saudi-Arabien, das Austragungsort erster Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland war, für seine Vermittlungsversuche erkenntlich zeigen, versprach der US-Präsident in Riad. Und auch Katars Status als Mediator von Afghanistan über Gaza bis Ostkongo hat die Bedeutung des Emirats für die USA gesteigert. Folgte 2017 dem damaligen Golf-Besuch Donalds Trumps noch unmittelbar die Katar-Blockade durch Saudi-Arabien, die VAE und andere Golf-Staaten – anfangs sogar mit Segen des US-Präsidenten – ist Doha nun zur zweiten Besuchsstation der Präsidentenreise aufgerückt, noch vor seinem Nachbarn Abu Dhabi, das einst weitaus engere Beziehungen zu Trump genoss.
Trumps Golf-Reise als Lehrstück für Europa?
Der Blick aus Europa zeigt auffällige Parallelen zwischen der Abhängigkeit der Golf-Staaten von den USA und der europäischen Stellung im transatlantischen Verhältnis: Beide benötigen amerikanische Sicherheitsgarantien, sind auf US-Hochtechnologie, wie KI-Chips, angewiesen und brauchen für politische Initiativen in ihrer Nachbarschaft – sei es die Unterstützung der Ukraine oder die Eingrenzung des iranischen Atomprogramms – das Wohlwollen des US-Präsidenten. Daher ist der Umgang des Golfs mit Trump kein unwichtiges Beispiel für ein Europa, das gegenwärtig sein Verhältnis zur amerikanischen Regierung neu ausloten muss.
Der Umgang der Herrscher am Golf mit US-Präsident Trump ist nicht unbedenklich – und die Bilder der Reise teils kurios. Finanzielle Vorteilnahme, intransparente Abkommen und eine nur auf persönlicher Affinität von Führungspersonen errichtete Partnerschaft sollten nur bedingt zum Vorbild genommen werden. Andererseits schaffen es die Golf-Staaten, ihre Positionen gegenüber den USA zu behaupten und gleichermaßen eigene Interessen beim Präsidenten durchzusetzen. Das sollte auch Zielvorstellung für europäische Entscheidungsträger sein. Nicht zuletzt eine stärkere Kooperation Europas mit den Golf-Staaten kann vor diesem Hintergrund helfen, um geostrategische Interessen gegenüber Washington durchzusetzen – und möglicherweise auch das Ansehen in den USA zu fördern.
Die Lehre, die sich aus dem Taktieren der Golf-Staaten beim Trump-Besuch ziehen lässt, ist, dass mehr erreicht, wer die Beziehungspflege zum amerikanischen Präsidenten vorneanstellt. Zumindest wirkt es wie eine kluge Vorsichtsmaßnahme, um sich bei den USA nicht unbeliebt zu machen. Wohlwollen selbst bei kontroversen Vorschlägen zu signalisieren, ohne dabei die eigenen strategischen Ziele aus den Augen zu verlieren, scheint in der Substanz bessere Ergebnisse zu erzielen als Grundsatzkritik an Trump. Die Golf-Staaten haben diesen Balanceakt perfektioniert. „Oh, was ich nicht alles für den Kronprinzen tun würde“, gestand Trump vor großem Publikum in Riad. Das Gelächter, das darauf im Saal erklang, spricht Bände.
Themen
Über diese Reihe
Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist in rund 110 Ländern auf fünf Kontinenten mit einem eigenen Büro vertreten. Die Auslandsmitarbeiter vor Ort können aus erster Hand über aktuelle Ereignisse und langfristige Entwicklungen in ihrem Einsatzland berichten. In den "Länderberichten" bieten sie den Nutzern der Webseite der Konrad-Adenauer-Stiftung exklusiv Analysen, Hintergrundinformationen und Einschätzungen.