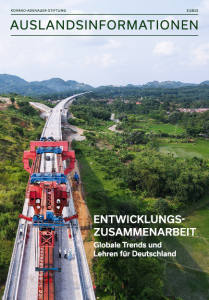Ausgabe: 3/2025
Auslandsinformationen (Ai): Deutschland und das Vereinigte Königreich gehören zu den führenden Gebern in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. In vielen Ländern jedoch geraten die Entwicklungsbudgets zunehmend unter Druck – einerseits aufgrund knapper öffentlicher Finanzen, andererseits infolge des Aufstiegs rechtspopulistischer Parteien, die sich klar gegen solche Ausgaben positionieren. Zunächst zu Ihrer Einschätzung: Wie hat sich diese Debatte im Vereinigten Königreich in den vergangenen Jahren entwickelt?
Sir Andrew Mitchell: Früher einmal herrschte unter der Führung von Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron und Theresa May ein breiter politischer Konsens über die Bedeutung internationaler Entwicklungszusammenarbeit. Alle Vier erklärten sie zu einer klaren Priorität. Selbst in den Hochphasen der Austeritätspolitik unter der konservativen Regierung von David Cameron blieb der Entwicklungsetat von den Sparmaßnahmen ausgenommen. Wir haben uns verpflichtet, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit auszugeben, und dieses Versprechen wurde eingehalten. Es war eine konservative Regierung, die als erste das 0,7-Prozent-Ziel erreicht hat.
Am Ende kommt es auf politische Führung an. Wenn Entscheidungsträger den Wert von Entwicklungszusammenarbeit betonen, prägt dies die öffentliche Meinung. Umgekehrt verlor die Entwicklungszusammenarbeit an Priorität, als Boris Johnson sein Amt antrat – gefolgt von Liz Truss und nun insbesondere Sir Keir Starmer. Johnson hatte nicht viel Respekt für das Thema übrig und kürzte die Ausgaben von 0,7 Prozent auf 0,5 Prozent, aber selbst er hätte es nicht gewagt, sie auf 0,3 Prozent zu kürzen. Genau das hat die derzeitige Labour-Regierung jedoch getan. Besorgniserregend ist, dass Umfragen zeigen, dass dies ihre bislang populärste politische Entscheidung war.
Wir leben heute in einer ganz anderen Zeit. Das öffentliche und politische Interesse an Entwicklungszusammenarbeit ist weitgehend erloschen. Das Vereinigte Königreich, einst ein Vorreiter bei der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, sendet nun ein ganz anderes Signal aus. Als ich Entwicklungsminister war, konnte ich meinen deutschen Amtskollegen anrufen und sagen: „Wir stellen erhebliche Mittel bereit – das sollten Sie ebenfalls tun.“ Heute hingegen rechtfertigen deutsche Politiker ihre eigenen Kürzungen mit dem Hinweis auf das britische Beispiel. Ein Land, das einst als Supermacht der Entwicklungszusammenarbeit galt, hat diese Rolle aufgegeben, und andere Nationen folgen diesem Kurs. Wir befinden uns derzeit in einem düsteren und herausfordernden Umfeld für die internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Ai: Wie ist dieser Wandel zu erklären?
Mitchell: Es gibt mehrere Gründe. Erstens steht das internationale System selbst unter enormem Druck. Da ist der verabscheuungswürdige Einmarsch Wladimir Putins in die Ukraine, durch den Infrastruktur zerstört und ukrainische Bürgerinnen und Bürger getötet werden. Es geht jedoch nicht nur um den Krieg, sondern auch darum, dass Putin eines der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats ist. Wenn die Vereinten Nationen durch ein solches Mitglied in ihren eigenen Reihen so tief gespalten werden, fällt es ihnen schwer, mit einer Stimme zu sprechen.
Zweitens erleben wir weltweit einen Aufschwung des Nationalismus: Von Xi Jinping bis Donald Trump, von Narendra Modi bis Recep Tayyip Erdoğan – der Nationalismus triumphiert. Den gleichen Trend sehen wir in Deutschland mit der AfD und in Frankreich mit der Le-Pen-Bewegung. Gerade in einer Zeit, in der wir ein starkes und geeintes internationales System brauchen, um auf Pandemien, Klimawandel und Migration zu reagieren, geraten wir stattdessen in die Fänge des Isolationismus.
Drittens mag es politisch einfach sein, die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit zu kürzen – die Folgen jedoch sind gravierend. Als sich die wohlhabenden Nationen hinter dem 0,7-Prozent-Ziel vereinten, war das ein Signal an den Globalen Süden: Wir sind bereit, unseren Worten Taten folgen zu lassen. Diese Botschaft ist nun verloren gegangen.
Ai: Was werden die Folgen sein?
Mitchell: Wenn das Vereinigte Königreich, die USA und möglicherweise auch Deutschland den afrikanischen Ländern ihre Unterstützung entziehen – nicht nur in Form von Entwicklungszusammenarbeit, sondern auch in Form von langfristigen Investitionen in Entwicklung und Regierungsführung – hinterlassen wir ein Vakuum. Und dieses Vakuum wird gefüllt werden: von Russland, China oder Terrornetzwerken in der Sahelzone. Menschen, die in extremer Armut leben, werden anfälliger für die Lockrufe der Terroristen, gerade dann, wenn diese auf reiche Nationen verweisen, die nur wenige Hundert Kilometer entfernt in Wohlstand leben.
Wir kehren erfolgreichen Projekten den Rücken. Nehmen wir das PEPFAR – den President’s Emergency Plan for AIDS Relief –, die von George W. Bush ins Leben gerufene Initiative zur Bekämpfung von HIV/AIDS am Horn von Afrika. Sie hat unzählige Leben gerettet. Nun, da USAID-Mittel gekürzt werden, ist die Versorgung mit lebensrettenden antiretroviralen Medikamenten in Gefahr. Zwischen 1990 und 2020 erlebten wir den größten Rückgang der weltweiten Armut in der Geschichte der Menschheit – dieser Fortschritt droht nun zunichtegemacht zu werden.
Abschließend möchte ich auf einen häufig angesprochenen Punkt eingehen: Wir hören, unter anderem von der Starmer-Regierung, dass die Mittel in die Verteidigung umgeleitet werden.
Ai: Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. War die Idee, das Entwicklungsbudget zugunsten höherer Verteidigungsausgaben zu kürzen, nicht ursprünglich ein Vorschlag der Konservativen?
Mitchell: Wir haben nie ausdrücklich gesagt, dass wir Gelder von der Entwicklungszusammenarbeit abziehen, um sie in die Verteidigung zu stecken. Das war nicht die Linie der Partei. Johnson hat die Mittel von 0,7 Prozent auf 0,5 Prozent gesenkt – als Begründung nannte er die durch die Pandemie entstandenen Schulden. Kein konservativer Regierungschef hat jedoch vorgeschlagen, die Entwicklungsausgaben zu kürzen, um damit die Verteidigung zu finanzieren.
Ich bin überzeugt, dass Entwicklung und Verteidigung zwei Seiten derselben Medaille sind. Soft Power ist zudem weit kostengünstiger als hard power. Wenn wir Instrumente von soft power – wir reden da von Krankheitsbekämpfung, Migrationssteuerung und Aufbau humanitärer Kapazitäten – vernachlässigen, verkennen wir das Gesamtbild völlig.
Ai: Aus diesem Grund haben Sie in einem früheren Kommentar die Umschichtung von Entwicklungsmitteln in die Verteidigung als „selbstzerstörerisch“ bezeichnet.
Mitchell: Genau: selbstzerstörerisch.
Ai: Lassen Sie uns einen weiteren Aspekt betrachten. Unter Boris Johnson kam es um 2020 zu einem deutlichen Wandel in der britischen Entwicklungspolitik. Zu den wesentlichen Veränderungen zählten die Haushaltskürzungen, aber auch die Zusammenlegung zweier Ministerien. Dies ist auch in Deutschland ein wiederkehrendes Diskussionsthema, unter anderem während der Koalitionsverhandlungen im vergangenen Frühjahr. Letztlich haben wir uns in Deutschland jedoch immer gegen eine Zusammenlegung entschieden. Angesichts Ihrer Regierungserfahrung als Staatsminister in ebenjenem zusammengelegten Außen-, Commonwealth- und Entwicklungsministerium, dem FCDO, sowie als stellvertretender Außenminister interessiert mich Ihre Perspektive: Sehen Sie in einer solchen Zusammenlegung eher Herausforderungen oder Chancen – insbesondere im Hinblick darauf, Entwicklungspolitik besser mit außen- und sicherheitspolitischen Zielen zu verzahnen.
Mitchell: Das ist ein wichtiger Punkt. In der Vergangenheit – wenn auch heute nicht mehr so ausgeprägt – wurde die Abstimmung zwischen Entwicklung, Verteidigung und Diplomatie im Vereinigten Königreich durch den Nationalen Sicherheitsrat erreicht. Er diente als Mechanismus, der diese Bereiche zusammenführte. Diese Abstimmung entstand nicht durch die Zusammenlegung von Ministerien.
Die Fusion des Ministeriums für Internationale Entwicklungszusammenarbeit, des DfID, mit dem Außenministerium war meiner Ansicht nach eine Katastrophe sondergleichen. Ein schwerwiegender Fehler.
Ai: Warum?
Mitchell: Weil das DfID ein stolzes Ministerium war, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich wussten, was sie taten. Dadurch war es unangefochtener Spitzenreiter in der Entwicklungspolitik. Das DfID führte Innovationen wie die Überprüfungen der multilateralen und bilateralen Entwicklungszusammenarbeit ein, die beide darauf abzielten, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Steuerzahler zu gewährleisten. Diese Ansätze erregten internationales Aufsehen. Amerikaner, Deutsche, Franzosen, Kanadier, Neuseeländer und Australier kamen alle zum DfID, um von unseren Praktiken zu lernen – viele davon übernahmen sie später selbst. Das DfID war nicht nur ein Ministerium; es beherbergte einige der besten Entwicklungsexpertinnen und -experten weltweit. Viele der einflussreichsten Ideen in diesem Bereich hatten dort ihren Ursprung und wurden international nachgeahmt. Ich habe immer gesagt, dass Amerika zwar eine militärische Supermacht sei, Großbritannien dafür eine Entwicklungssupermacht. Niemand widersprach dieser Einschätzung. Ich würde sagen, seit der Suez-Krise war das einzige Beispiel für echte und respektierte britische Führungsstärke die britische Arbeit im Bereich der internationalen Entwicklung.
Nach der Zusammenlegung verflüchtigte sich diese Expertise jedoch rasch. Die Fachleute, die im gesamten internationalen System – etwa bei den Vereinten Nationen, dem Welternährungsprogramm oder anderen Institutionen in New York, Genf oder Washington – hohes Ansehen genossen, verließen ihre Ämter. Sie waren nicht bereit, sich der Führung durch die Diplomaten des Außenministeriums unterzuordnen. Die Folge waren Verwirrung und interne Grabenkämpfe innerhalb des Ministeriums. Die Zielklarheit und Führungsstärke, die Großbritannien einst echtes Gewicht in der Entwicklungspolitik verliehen hatten, gingen verloren.
Ai: Unwiederbringlich?
Mitchell: Eine Wiederbelebung des DfID wäre äußerst schwierig, denn die Menschen zögern verständlicherweise, in eine Struktur zurückzukehren, die erneut auseinandergenommen werden könnte. Dies ist bereits zweimal geschehen, und viele befürchten, dass es auch ein drittes Mal passieren würde. Zudem werden die wenigen hochrangigen Beamtinnen und Beamten aus dem ehemaligen DfID, die noch im zusammengelegten Ministerium verblieben sind, ihre letzten Karrierejahre kaum mit dem Wiederaufbau eines Ministeriums und der Bewältigung ressortübergreifender Konflikte verbringen wollen.
Ai: Wenden wir uns der Frage der Prioritäten und des regionalen Fokus unter der konservativen Regierung zu. Was waren die Hauptziele in Bezug auf die verschiedenen Sektoren? Lag der Schwerpunkt primär auf der Armutsbekämpfung oder eher auf der wirtschaftlichen Entwicklung?
Mitchell: All dies wird in dem von mir verfassten Weißbuch, das im November 2023 von Rishi Sunak vorgestellt wurde, sehr deutlich dargelegt. Armutsbekämpfung steht zwar schon im Titel, doch die überzeugendsten Kapitel beschäftigen sich mit Finanzen und Investitionen.
Der zentrale Gedanke lautet, dass der effektivste Weg, Menschen aus der Armut zu befreien – ob im Vereinigten Königreich oder in den ärmsten Ländern der Welt – darin besteht, dass sie wirtschaftlich aktiv sind. Es geht darum, Arbeit zu haben und Chancen zu schaffen. Deshalb sind Investitionen so wichtig, insbesondere durch die Entwicklungsfinanzierungsinstitution des Vereinigten Königreichs, BII genannt, die meiner Meinung nach mittlerweile die weltweit führende Entwicklungsfinanzierungseinrichtung ist. Die BII investiert derzeit eine Dreiviertelmilliarde US-Dollar in Afrika.
Dabei handelt es sich nicht um Kredite, sondern um Risikokapital. Die Empfänger zahlen das Geld nicht im herkömmlichen Sinne zurück. Es handelt sich um eine Art von langfristiger Investition und einen der wichtigsten Wege, Wohlstand zu schaffen.
Ai: Bedeutet das, dass auch Handels- und Investitionserwägungen einfließen, die sich an den nationalen Interessen des Vereinigten Königreichs orientieren?
Mitchell: Selbstverständlich. Aber es geht um mehr als das. Internationale Entwicklung zielt darauf ab, Konflikte zu beenden und danach Gesellschaften zu versöhnen und wieder aufzubauen. Sie soll auch den Wohlstand fördern, denn einen Arbeitsplatz zu haben und wirtschaftlich aktiv zu sein, ist für Menschen der effektivste Weg, der Armut zu entkommen. Deshalb würde ich argumentieren, dass jeder Penny an Entwicklungsgeldern unseren nationalen Interessen dient.
Ai: Apropos nationale Interessen: In der Vergangenheit wurde die Entwicklungszusammenarbeit vor allem moralisch begründet. Es ging um die globale Verantwortung von Ländern wie dem Vereinigten Königreich, Deutschland und anderen europäischen Staaten. Heute ist diese moralische Perspektive jedoch weitgehend verschwunden. Die Diskussion konzentriert sich nun viel stärker auf nationale Sicherheit und außenpolitische Prioritäten. Angesichts der Tatsache, dass das Vereinigte Königreich eines der ersten Länder war, das bei der Rechtfertigung von Entwicklungsausgaben stark mit den nationalen Interessen argumentierte, würde mich Ihre Einschätzung interessieren: Wie erfolgreich war dieser Ansatz, nationale Sicherheitsinteressen über moralische Verpflichtungen zu stellen?
Mitchell: Das ist wieder ein sehr interessanter Punkt. Wir haben viel Zeit damit verbracht, darüber zu diskutieren, insbesondere in Gesprächen mit Forscherinnen und Forschern der Universitäten Birmingham und London, die die öffentliche Meinung zu Entwicklungsfragen genau beobachten. Im Vereinigten Königreich lehnt etwa die Hälfte der Bevölkerung Entwicklungsausgaben ab, weil sie sie als Geldtransfer ins Ausland empfindet. Ihr Standpunkt lässt sich oft mit dem Satz „Wohltätigkeit beginnt zu Hause“ zusammenfassen, worauf ich immer antworte: „Ja, aber sie endet nicht dort.“
Die andere Hälfte der Bevölkerung hingegen glaubt, dass internationale Entwicklungszusammenarbeit richtig ist. Diese Menschen sind der Ansicht, dass Großbritannien eine positive Rolle in der Welt spielen sollte und dass wir mit diesem kleinen Betrag dazu beitragen sollten, eine bessere Welt zu schaffen für Menschen, die von Katastrophen und Not betroffenen sind. Meinungsforscher sagen, das moralische Argument greife am besten. Meiner Ansicht nach haben wir jedoch bereits diejenigen erreicht, die auf diese Argumentation anspringen. Die Herausforderung besteht nun darin, ein neues Narrativ zu entwickeln, das zwar die moralische Notwendigkeit weiterhin anerkennt, aber auch deutlich macht, wie sehr es in unserem nationalen Interesse liegt, Entwicklungszusammenarbeit zu betreiben. Auf diese Weise können wir die öffentliche Unterstützung erhöhen.
Ai: Wie erfolgreich war dieser Ansatz?
Mitchell: Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein: Es ist uns bisher nicht gelungen, die breite Öffentlichkeit mit dem Argument der nationalen Interessen zu überzeugen. Interessanterweise nahm aber die öffentliche Unterstützung für die Entwicklungszusammenarbeit während der Sparpolitik unter David Cameron sogar zu. Es ist also nicht unmöglich. Damals haben wir nachdrücklich dafür plädiert, dass Entwicklungsausgaben dem nationalen Interesse dienen, und dieses Argument gewann zumindest etwas an Zugkraft.
Nun müssen wir jedoch einsehen, dass wir in der Defensive sind und dass Kürzungen der Entwicklungsausgaben sehr populär sind. Wir müssen ein neues, überzeugendes Argument finden, das die Menschen dazu bringt zu sagen: „Ja, ich verstehe, warum wir mehr Geld für internationale Entwicklung ausgeben sollten.“ Aus diesem Grund führen wir derzeit Gespräche mit vielen Akteuren aus dem internationalen philanthropischen Sektor und aus dem politischen Raum. Wir hoffen, diesen Dialog auch mit der Konrad-Adenauer-Stiftung fortsetzen zu können.
Ai: Wenn die Menschen in Ihrem Wahlkreis Sie bitten würden, ein oder zwei Beispiele zu nennen, wo Entwicklungszusammenarbeit wirklich funktioniert hat – was würden Sie ihnen sagen?
Mitchell: Ich würde sagen, dass man in Afrika, insbesondere in Kenia, aber auch in Nigeria und Ruanda, sehen kann, wie britische Entwicklungszusammenarbeit zur Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt. Und diese Investitionen fließen nach Großbritannien zurück, denn wenn beispielsweise Ruanda Kapital aufnehmen will, nutzt es unsere Kapitalmärkte. Das ist also eine Möglichkeit, wie britische Entwicklungszusammenarbeit Wohlstand schafft.
Ein weiteres Beispiel verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Konfliktbeilegung: Somalia ist ein Land, in dem Großbritannien stark investiert. Und das nicht nur, weil wir es wollen. Wir wissen, dass Frauen und Kinder in Somalia unter schrecklichen Bedingungen leben. Ich trage immer dieses Armband gegen weibliche Genitalverstümmelung, und Großbritannien hat sehr gute lokale Organisationen unterstützt, die darauf abzielen, diese Praxis zu verhindern. Es ist nicht nur eine moralische Frage – es ist auch eine Sicherheitsfrage: Indem wir die Regierungsführung in Somalia verbessern, helfen wir, die Al-Shabaab-Terroristen zurückzudrängen. Zeitweise wurden in Somalia mehr britische Staatsbürger in Terroristenlagern ausgebildet als in Afghanistan und Pakistan. Indem wir dort eingreifen, stoppen wir also nicht nur Terror und Elend in Somalia, sondern verhindern auch, dass uns diese Probleme möglicherweise irgendwann auf den Straßen von Berlin, London oder Birmingham einholen.
Ai: Wenn wir über die heutige internationale Entwicklungszusammenarbeit sprechen, gibt es einen Aspekt, den wir noch nicht ausführlich behandelt haben, der aber unbedingt erwähnt werden muss: die US-Entwicklungspolitik. Welche Auswirkungen wird der Rückzug der USA aus der Entwicklungszusammenarbeit auf das internationale System insgesamt haben?
Mitchell: Der Rückzug der USA ist in der Tat äußerst gravierend, denn sie haben dasselbe getan wie die Johnson-Regierung: Es wurden unterjährig Kürzungen vorgenommen, was bedeutet, dass man zu seinen Partnern gehen und sagen muss: „Es tut mir leid, aber wir können nicht zahlen, obwohl wir einen Vertrag unterzeichnet haben.“ Als Folge dieser Entscheidung im Hinblick auf USAID wurden Kliniken in Afrika geschlossen. Sie durften nicht einmal die antiretroviralen Medikamente verwenden, die sie bereits gelagert hatten, was eine katastrophale Entwicklung ist. Beim Thema Nahrungsmittelhilfe, wo die USA der größte Geber sind, ist noch unklar, was passieren wird. Früher nahm man den amerikanischen Landwirten die Überschüsse ab und bestand darauf, sie mit amerikanischen Schiffen rund um die Welt zu verschiffen. Das war also ein sehr nationalistisches Vorgehen. Ich glaube nicht, dass sie die Nahrungsmittelhilfe wirklich einstellen werden, denn es gibt Landwirte, die für den Bedarf des amerikanischen Binnenmarkts zu viel produzieren. Diese Landwirte erwarten, dass ihre Ernten im Ausland verwendet werden. Ich bin mir also nicht sicher, inwieweit der Rückzug der USA die Nahrungsmittelhilfe beeinträchtigen wird. Dennoch war die Entscheidung bezüglich USAID unglaublich schlecht für den Ruf Amerikas. Die Kürzungen haben reale Auswirkungen auf die Gesundheit und die Bildung schutzbedürftiger Menschen und werfen ein äußerst negatives Licht auf Amerika. Aber das kümmert einen isolationistischen Präsidenten wahrscheinlich wenig.
Ai: Lassen Sie uns unser Gespräch mit einem allgemeinen Ausblick abschließen: Wie wird Ihrer Meinung nach die Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit aussehen?
Mitchell: Es wird insgesamt weniger Geld zur Verfügung stehen und der Schwerpunkt wird zunehmend auf Investitionen liegen. Derzeit heißt es: „Die afrikanischen Länder wollen keine Hilfe, sie wollen Investitionen.“ Und das stimmt natürlich. Großbritannien ist mit der BII weltweit führend in dieser Hinsicht. Als ich in die Regierung kam, hatte die BII 47 Mitarbeiter. Mit den Reformen, die wir während meiner Zeit beschlossen haben, sank die Zahl auf 17. Heute arbeiten über 800 Menschen dort und tätigen Investitionen in arme Länder. Genau dahin wird der Trend gehen und die Regierungen werden diese Investitionen unterstützen. Aber man kann nicht erwarten, dass Investitionen in sehr arme Länder erfolgreich sind, wenn man nicht gleichzeitig die Menschen dort in ihren Fähigkeiten stärkt – das erfordert Bildung und funktionierende Gesundheitssysteme. Natürlich können wir die Zuschussfinanzierung deutlich reduzieren, wie wir das bereits getan haben und weiterhin tun werden. Und wir können das Geld in technische Hilfe investieren. Aber letztlich werden diese Länder Gelder benötigen, sei es über multilaterale, sei es über bilaterale Kanäle.
Insgesamt denke ich also, dass Investitionen stärker im Vordergrund stehen werden. Der Schwerpunkt wird eher auf technischer Hilfe als auf Subventionen liegen. Und ich denke, es wird eine strengere Vorgehensweise geben – wie sie in Großbritannien bereits durch die Unabhängige Kommission zur Bewertung der Entwicklungshilfe umgesetzt wurde. Außerdem einen stärkeren Fokus auf Rechenschaftspflicht und Transparenz sowie die Einsicht, dass unsere Länder im Katastrophenfall eine Vorreiterrolle bei der Hilfe und Unterstützung von Menschen in Not einnehmen müssen. Über diese einzelnen Punkte hinaus braucht es jedoch ein übergreifendes Narrativ, das die Bedeutung von Entwicklung unterstreicht, um diese zu fördern und mehr öffentliche Unterstützung zu gewinnen. Wir haben diesem Thema zwar viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber offenbar nicht genug getan. Trotzdem sollten wir daran weiterarbeiten und genau dabei wird dann hoffentlich auch die Konrad-Adenauer-Stiftung eine Rolle spielen.
Ai: Sir Andrew, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre aufschlussreichen Einschätzungen.
– übersetzt aus dem Englischen –
Sir Andrew Mitchell ist ein hochrangiger britischer Politiker der Konservativen Partei, der von 2010 bis 2012 als Minister für internationale Entwicklung und von 2022 bis 2024 als Staatsminister für Entwicklung und Afrika tätig war. Er war außerdem stellvertretender Außenminister und danach Schattenaußenminister. Sir Andrew wurde 1987 zum ersten Mal ins Parlament gewählt und vertritt derzeit den Wahlkreis Sutton Coldfield.