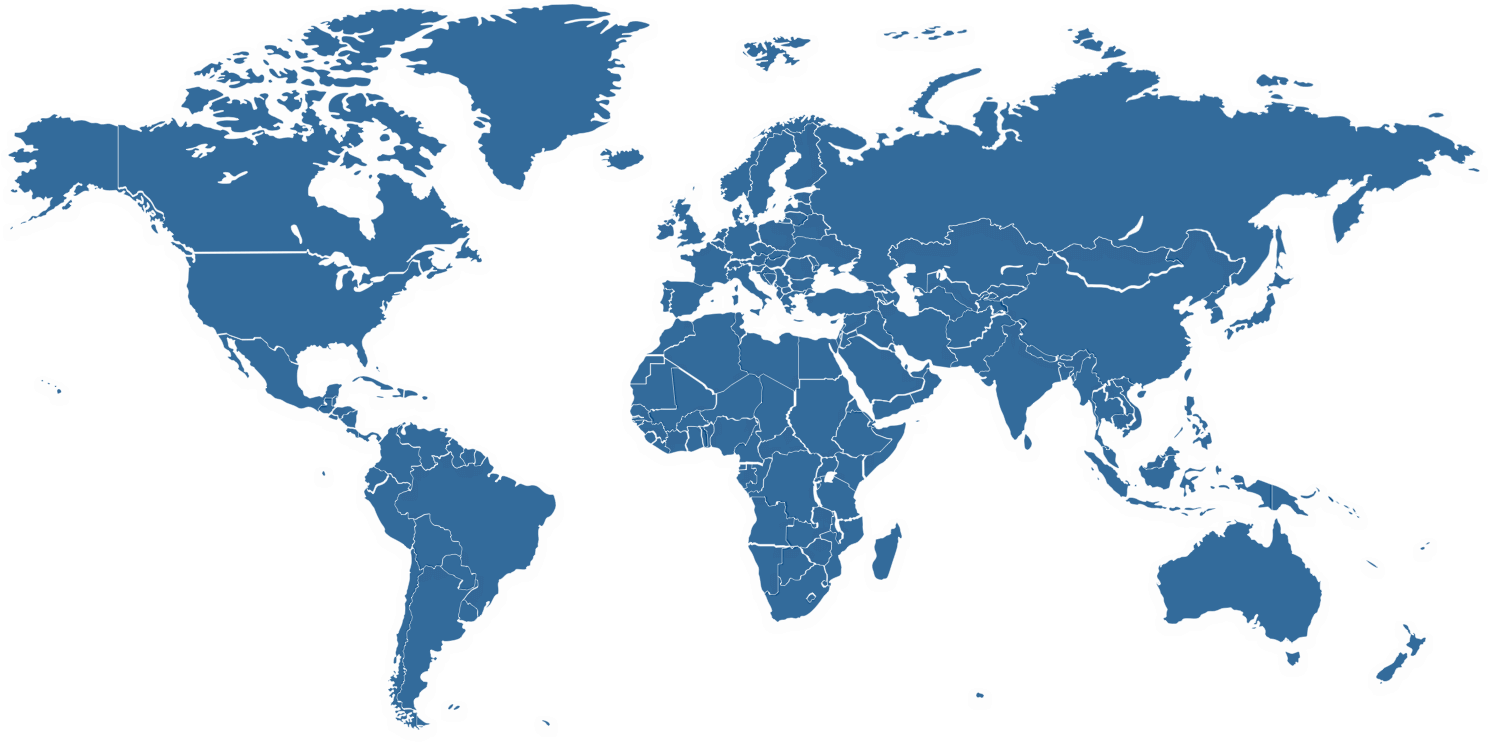Riga ist nicht nur das administrative und wirtschaftliche Zentrum Lettlands, sondern auch ein politisches Barometer für landesweite Stimmungen. Die Metropole mit ihren rund 600.000 Einwohnern stellt mehr als ein Drittel der gesamten Bevölkerung dar und ist geprägt von einer multikulturellen, urbanen Gesellschaft. Die Kommunalwahl in Riga wurde somit zum Schlüsseltest für alle größeren politischen Kräfte.
Vieles stand im Vorhinein der Wahlen unter dem Aspekt eines potenziellen Sicherheitsrisikos. Das lag vornehmlich an zwei Personen: Zum einen an Ainārs Šlesers, seit vielen Jahren in der lettischen Politik aktiv (u.a. als Minister und als Mitbegründer mehrerer kurzlebiger Parteien). Er positioniert sich als „Anwalt des kleinen Mannes“ und stellt die Wirtschaft in den Mittelpunkt. Šlesers steht jedoch auch für Oligarchie und eine Monopolisierung innerhalb der Politik und Wirtschaft, die er seit 1998 mit vorantreibt.
Die zweite Persönlichkeit, die ein drohendes Sicherheitsgefühl befeuert, ist Aleksejs Rosļikovs, Gründer der prorussischen Partei „Stabilitātei!” (Für Stabilität). In der letzten Plenumswoche sorgte er im nationalen Parlament für Aufstehen, als er seine Rede mit den Worten “Es gibt mehr von uns! Und Russisch ist unsere Sprache!”, gehalten auf Russisch und mit einer vulgären Geste beendete. Der Staatssicherheitsdienst leitete am 9. Juni ein Strafverfahren gegen Rosļikovs ein. Beides unterfütterte das allgemeine Gefühl, dass die Kommunalwahlen – gerade in der Hauptstadt Riga – zu einem Richtungswechsel der lettischen (Außen-)Politik führen könnten.
Exemplarisch für die Entwicklung Lettlands hier nachfolgend die Ergebnisse für Riga:
| Partei | Prozent | Sitze |
|---|---|---|
| Latvija pirmajā vietā ("Lettland zuerst") | 18,16 | 13 |
| Progresīvie („Progressiven“) | 16,6 | 11 |
|
Nacionālā apvienība („Nationale Allianz“) |
14,16 | 10 |
|
Jaunā Vienotība („Neue Einheit“) |
12,93 | 9 |
| Suverēnās varas („souveräne Mächte“) und Apvienības Jaunlatvieši („Union der neuen Letten“) | 12,17 | 8 |
| Stabilitātei! (“Stabilität”) | 6,94 | 5 |
| Apvienotais saraksts („Vereinte Liste“) | 6,29 | 4 |
**Weitere Parteien, die unter 5 Prozent sind, wurden nicht aufgeführt.
Wahlsystem nach dem d’Hondt-Verfahren
Die Kommunalwahlen in Lettland folgen einem Verhältniswahlrecht mit geschlossenen Listen. Jede Gemeinde bzw. Stadt bildet einen eigenen Wahlkreis – in Riga sind es beispielsweise 60 Mandate. Die Wähler stimmen für eine Parteiliste und können innerhalb dieser Liste Kandidaten durch ein „grünes“ oder „rotes“ Kreuz aufwerten oder in der Listenplatzierung sinken lassen. Diese personalisierte Stimmabgabe beeinflusst nur die Reihenfolge der Kandidaten, nicht die Sitzverteilung der Parteien.
Entscheidend ist die Fünf-Prozent-Hürde: Nur Listen, die mindestens 5 Prozent der gültigen Stimmen im jeweiligen Wahlkreis erreichen, werden bei der Sitzverteilung berücksichtigt. Die abgegeben Simmen werden jedoch nicht wertlos, sondern werden nach dem mathematischen d’Hondt-Verfahren proportional auf die erfolgreichen Listen verteilt. Dieses Verfahren begünstigt größere Parteien leicht, da deren Stimmen besser „verwertet“ werden. Es ist jedoch stabilitätsfördernd, da es Koalitionen erleichtert.
Wahlbeteiligung als Indikator für demokratische Legitimität
Die Wahlbeteiligung ist ein entscheidender Indikator für die demokratische Vitalität eines Landes. In den letzten Jahren ist in Lettland jedoch ein kontinuierlicher Rückgang der Beteiligung an Kommunalwahlen zu verzeichnen, auch in Riga. Im Jahr 2013 gaben landesweit fast 59 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab; 2021 sank diese Zahl auf 34 Prozent, was die niedrigste Wahlbeteiligung seit der Wiederherstellung der Unabhängigkeit darstellte. In diesem Jahr lag die Wahlbeteiligung landesweit bei 47 Prozent. Die starke Polarisierung, vor allem von Šlesers und Rosļikovs, hat zu einer Steigerung beigetragen, ohne große regionale Unterschiede. Dass es ausländische Einmischungs- oder Beeinflussungsversuche gegeben hat, ist bislang nicht bekannt bzw. anzunehmen.
Vienotība und Vilnis Ķirsis: Verteidigung der Mitte
In diesem herausfordernden Umfeld trat Bürgermeister Vilnis Ķirsis als Spitzenkandidat der „Neuen Einheit“ (EVP) in Riga zur Wiederwahl an. Die Partei, die sich klar zur europäischen Integration, zur transatlantischen Partnerschaft und zu marktwirtschaftlicher Ordnungspolitik bekennt, steht in der Hauptstadt für Stabilität und Verwaltungsmodernisierung.
Ķirsis wurde 2023 nach dem Rücktritt des damaligen Bürgermeisters Mārtiņš Staķis, vom Stellvertreter zum Bürgermeister von Riga. Sein Fokus lag auf dem Umbau der Verwaltung, hin zu mehr Transparenz. Der Mangel hieran – und Šlesers‘ Aktivitäten in diesem Zusammenhang – war einer der Gründe für Kirsis Eintritt in die Politik vor vielen Jahren. Bis zur vorletzten Kommunalwahl (2020) lagen über 40 Kriminalverfahren gegen die Rigaer Regierung und deren Bürgermeister Nils Ušakovs (Saskana; „Harmonie“ (S&D)) vor. Gegen die letzte von Kirsis geführte Regierung sind null Verfahren anhängig.
Für die Partei von Bürgermeister Kirsis, „Neue Einheit“, ist das Ergebnis zufriedenstellend. Haben die Umfragen vorab doch ein viel düsteres Bild gezeichnet. Man verlor insgesamt nur einen Sitz, hat jedoch gute Chancen, wieder Teil der Regierungskoalition im Rigaer Stadtrat zu sein. Auch wenn Kirsis kein Volkstribun ist, so steht er stellvertretend für Kontinuität. Ein Attribut, was in hektischen Zeiten an Wert gewinnt.
Stimmung in den Regionen: Lokale Themen, nationale Wirkung
Während in Riga europäische Werte, urbane Mobilität und digitale Transformation im Vordergrund standen, konzentrierten sich die Themen in Regionen wie Vidzeme, Latgale oder Zemgale stärker auf:
- Infrastrukturprobleme (Straßen, Breit-bandzugang)
- Abwanderung junger Menschen
- Landwirtschaftliche Förderpolitik und
- Mangel an Arbeitsplätzen.
Auffällig war, dass auch in einigen Regionen populistische Rhetorik – besonders in Latgale – auf fruchtbaren Boden stieß. Dort fanden Šlesers und ähnliche Kandidaten eine Zuhörerschaft, die sich von Riga entfremdet fühlt. Die teils schockierende Beobachtung, dass andere Parteien und Kandidaten in solchen Regionen gar nicht mehr antraten oder den Wahlkampf auf ein Minimum konzentrierten, ist ein alarmierendes Signal an die politischen Kräfte. Insgesamt ist jedoch kein allgemeiner negativer Trend des populistischen Vormarsches erkennbar.
Bemerkenswert waren die Ergebnisse der Kommunalwahlen in der Region Latgale, im Osten Lettlands. In deren größter Stadt Daugavpils (zweitgrößte Stadt Lettlands) wurde das deutlichste Wahlergebnis einer Partei bzw. Liste mit 68,25 Prozent eingefahren. Es ging an den amtierenden Bürgermeister, Andrejs Elksniņš, von der Partei Sarauj, Latgale! („Vorwärts Latgale!“).
Die Region Latgale weist im Schnitt fast 38 Prozent russischsprachige Bevölkerung auf. Die Partei positioniert sich stark regional, mit Fokus auf zweisprachige Identität (Russisch und Latgalisch, ein regionaler Dialekt des Lettischen) – was strukturell Raum schafft für Nähe zu russischen Kulturaspekten. Elksniņš vermied es in der Vergangenheit sich klar zur Ukraine, im Krieg gegen Russland, zu positionieren. Mit 14 von 15 Sitzen im Stadtrat hat er nun eine starke Machtbasis in Lettlands zweitgrößter Stadt. Gleichwohl konnte auch die Zaļo un Zemnieku savienība („Union der Grünen und Bauern“) einen Großteil der Städte in der Region Latgale für sich entscheiden. Diese Partei steht für eine zentristisch-konservative Allianz mit starkem Fokus auf Land- und Regionalpolitik.
Das Wahlbündnis Latvija pirmajā vietā/Kopā Latvijai („Lettland zuerst“/“Gemeinsam Lettland“) des ehemaligen Bürgermeisters von Rēzekne (Region Latgale), Aleksandrs Bartaševičs, gewann bei den Kommunalwahlen 2025 in Rēzekne eine klare Mehrheit und sicherte sich mit 50,55 Prozent der Stimmen 8 von 13 Sitzen, wie aus vorläufigen Ergebnissen der Zentralen Wahlkommission hervorgeht.
Bartaševičs hatte den Rat bereits nach den Wahlen 2021 für die Partei Saskana ("Harmonie") geführt, wurde aber 2023 wegen seiner umstrittenen Haltung zur russischen Invasion in der Ukraine und der angeblichen Imageschädigung der Partei von dieser ausgeschlossen. Er gründete die "Kopā Latvijai", in der er sich mit anderen ehemaligen Ratsmitgliedern zusammenschloss. Nach schweren finanziellen Schwierigkeiten und Unsauberkeiten im selben Jahr wurde Bartaševičs seines Amtes enthoben - eine Entscheidung, die er bis heute vor Gericht anficht. Die Dysfunktion führte dazu, dass die Saeima (lettisches Parlament) den Rat auflöste und Mitte 2024 eine Übergangsverwaltung ernannt wurde.
Dies verdeutlicht die starke politische Zersplitterung auf Gemeindeebene, mit vielen lokalen Wählvereinigungen und Populisten jedoch auch gut etablierten Parteien.
Comeback der Oligarchen und Abstrusen
In Riga erzielte die Partei „Lettland zuerst“ unter Ainārs Šlesers einen Wahlerfolg und erzielte die meisten Sitze im Stadtrat. Šlesers, der bereits in der Vergangenheit als Verkehrsminister tätig war, hatte sich mit populistischen Parolen positioniert. Sein Erfolg in der Hauptstadt deutet auf eine wachsende Unzufriedenheit mit der etablierten Politik hin. Dennoch blieb er selbst unter den eigenen Erwartungen, die er einmal bei 30 Prozent taxiert hatte.
Die linksliberalen „Progressiven“ verlieren zwar im Vergleich zum letzten Wahlbündnis einige Sitze, haben jedoch als zweitstärkste Partei „der demokratischen Mitte“ die Aufgabe der Koalitionsbildung erhalten.
Die größte Überraschung ist das Bündnis "Suverēnās varas" (souveräne Mächte) und "Apvienības Jaunlatvieši" (Union der neuen Letten). Sie sind Abtrünnige der linkspopulistischen und russophilen „Stabilität!“ und Sasakana Parteien, denen diese Parteien zu zentristisch waren und ihre Aufgabe als Opposition nicht vernünftig wahrgenommen haben. Einen besonders bitteren Beigeschmack hat diese Konstellation aufgrund ihres Namens. Geht die „Union der neuen Letten“ doch auf eine Gruppe von Patrioten zurück, die im 19. Jahrhundert als erste Letten eine Hochschulbildung (u.a. im estnischen Tartu oder damals zaristischen St. Petersburg) erlangten. Aus dieser Gruppe geht das Staatsepos „Lāčplēsis“ und die Gründung der Sang- und Tanzfeste hervor. Beides Fundamente der „lettischen Seele“. Die nunmehr in den aktuellen Parteien Vertretenen stellen durch ihre extreme – teils abstruse – Ansichten jedoch genau das gegenteilige Bild dar.
Die Partei „Harmonie“, die lange Jahre den Bürgermeister von Riga stellte und wesentliche Kraft in der Landespolitik Lettlands war, verliert weiter an Boden. Der Niedergang der früher maßgeblich auf russischsprachige Wähler abzielenden Partei nimmt durch die kontinuierliche Fragmentierung in diesem Wählersegment weiter seinen Lauf.
Die Suche nach dem Kitt
Die Wahlergebnisse in Riga deuten auf mehr Stabilität als zunächst vorhergesagt hin. Denn Kontinuität im Stadtrat ist nach der Wahl eine ernstzunehmende Option. Viesturs Kleingers, der Parteivorsitzende der „Progressiven“ beginnt seine Koalitionsgespräche am Montag nach der Wahl mit der nächstgrößten Partei, „Nationalen Allianz“. Am Dienstag folgt sodann „Neue Einheit“ usw.
Die bisherige Koalition aus „Progressiven“, „Neue Einheit“ und „Nationale Allianz“ käme auf 30 von 60 Sitzen. Zwar ausreichend aber politisch sehr riskant. Die Hinzunahme der „Vereinten Liste“ ist daher eine angedachte Option und würde die alte Mehrheit von 34 Sitzen herstellen.
Die endgültige Koalitionsbildung wird entscheidend für die zukünftige Ausrichtung der Hauptstadt sein und könnte Signalwirkung für die nationale Politik haben. Daher soll sie schnell abgeschlossen werden. Alle Parteien der „demokratischen Mitte“ haben Offenheit signalisiert. Die „Nationale Allianz“ fordert jedoch eine Bekennung aller möglichen Partner auf ihre „Sicherheitsagenda“. Was diese genau beinhaltet, ist nicht eindeutig.
Ausblick
Die Wahlen am 7. Juni 2025 sind kein isoliertes kommunales Ereignis. Sie spiegeln größere Entwicklungen wider: das Aufkommen illiberaler Bewegungen in einem EU- und NATO-Mitgliedstaat, die Fragilität urbaner Demokratien sowie die Polarisierung im postpandemischen Europa.
Die erhöhte Wahlbeteiligung und das klare landesweite Ausbleiben starker anti-system oder pro-russischer Kräfte ist ein klares Statement der Bürger für einen pro-EU bzw. westlichen Kurs. Kontinuität ist das erwünschte Resultat. Das betrifft vor allem die großen Städte, inklusive Riga. Für den amtierenden Bürgermeister und seine Partei „Neue Einheit“ ist dieses Ergebnis in Ordnung, vor allem basierend auf dem bisherigen Abwärtstrend auf nationaler Ebene und zunehmender Kritik am Führungspersonal. Es zeigt sich aber erneut, dass Regionalwahlen weniger ideologisch und mehr über die Personen entschieden werden.
2026 finden in Lettland Parlamentswahlen statt. Die Zeit drängt also. Wenn die Partei „Neue Einheit“ sich inhaltlich und vor allem personell nicht neu und frisch aufstellt, droht sich der Abwärtstrend, der bei den jetzigen Kommunalwahlen leicht kaschiert wurde, auf nationaler Ebene zu verstetigen.
Interessant bleibt zu beobachten, wie sich die Partei von Šlesers, die zwar die meisten Stimmen in Riga erhalten hat, aber wohl keiner Koalition angehören wird, verhalten wird. Erste Ankündigen von ihm, dass er bei einer Nicht-Beachtung öffentlichen Druck über Demonstrationen auf die Regierung (direkt in Riga und indirekt auf nationaler Ebene) ausüben wird, deuten auf eine zunehmende Polarisierung hin.
Das „starke“ Abschneiden des Bündnisses „souveräne Mächte“ und „Union der neuen Letten“ führt zu einer Fragmentierung der russischsprachigen Wählergruppe. War es bislang maßgeblich „Harmonie“, die diese Wählerschicht bei Wahlen einte, sind es nunmehr zwei weitere Kräfte: Stabilität (nahm diesen Platz bereits bei den letzten Parlamentswahlen 2022 ein) und eben das vorgenannte Bündnis. Eine weitere Polarisierung des politischen Spektrums durch dieses Bündnis ist zu erwarten.
Insgesamt steht für Lettland die Frage im Raum, ob eine politische Kultur des Kompromisses und der Pluralität gefestigt oder durch Polarisierung ersetzt wird.
In diesem Spannungsfeld ist es Aufgabe der demokratischen Kräfte inklusive der Regierungspartei(en), die Wählerinnen und Wähler mit konkreten Lösungsansätzen für deren Probleme zu überzeugen. Aktuell scheint Kontinuität gewährt, doch es stehen fordernde politische Zeiten bevor. Im Herbst 2026 steht der nächste Test vor der politischen Haustür.
Bereitgestellt von
Auslandsbüro Baltische StaatenThemen
Über diese Reihe
Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist in rund 110 Ländern auf fünf Kontinenten mit einem eigenen Büro vertreten. Die Auslandsmitarbeiter vor Ort können aus erster Hand über aktuelle Ereignisse und langfristige Entwicklungen in ihrem Einsatzland berichten. In den "Länderberichten" bieten sie den Nutzern der Webseite der Konrad-Adenauer-Stiftung exklusiv Analysen, Hintergrundinformationen und Einschätzungen.