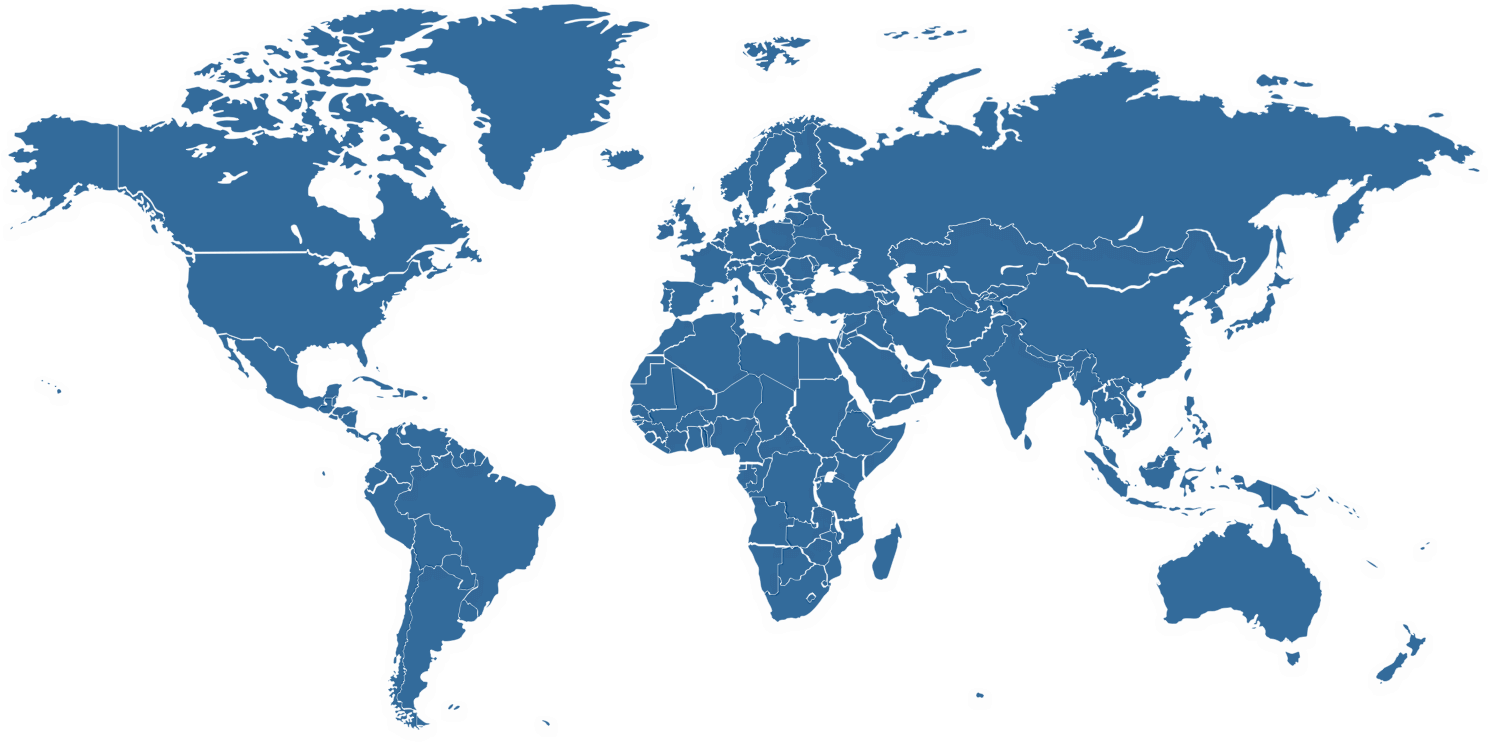Es existieren zwei völlig gegenteilige Ansätze, um das Verhältnis zwischen der Innen-, Außen- und Sicherheitspolitik Japans zu analysieren. Einer besteht darin, sich auf die jeweiligen politischen Führungspersönlichkeiten und ihre Kabinette zu konzentrieren und zu verfolgen, welche politischen Überzeugungen und Maßnahmen jedes von ihnen vertreten und ergriffen hat. Diese Methode ließe sich als „deduktiv“ beschreiben, während die im Folgenden beschriebene Methode vielmehr „induktiver“ Natur ist, da sie den Prozess der japanischen Außenpolitik in aufeinanderfolgender Weise erörtert. In diesem Zusammenhang klärt sie zunächst, welche Angelegenheiten Japan auf außen- und sicherheitspolitischer Ebene „erschüttert“ haben, und zeigt anschließend auf, wie die japanische Regierung und Öffentlichkeit darauf reagiert haben, welche Maßnahmen gefordert wurden und wie diese die Außen- und Sicherheitspolitik der jeweiligen Kabinette beeinflusst haben.
In diesem Beitrag habe ich mich für letzteren Ansatz entschieden. Der Grund dafür liegt darin, dass der japanische Staat im Voraus keine festen strategischen Sichtweisen entwirft, nach denen er seine Politik ausrichtet. Stattdessen handelt es sich vielmehr um einen „anpassungsfreudigen Staat“, der von außen kommende Erschütterungen aufnimmt und eine darauf abgestimmte Politik entwickelt und umsetzt.
(...)
Unter der Annahme, dass Japan ein anpassungsfreudiger Staat ist, möchte ich in diesem Beitrag erörtern, wie die Öffentlichkeit und Innenpolitik Japans seine Außen- und Sicherheitspolitik beeinflusst haben. Im Einzelnen beleuchte ich dabei vier Fälle, die sich seit 2010 ereignet und erheblich auf Japan ausgewirkt haben.
Lesen Sie das ganze Kaptiel hier.
Die in diesem Bericht geäußerten Ansichten sind ausschließlich die der Autoren und spiegeln nicht die Ansichten der Konrad-Adenauer-Stiftung oder ihrer Beschäftigten wider.